 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 Platz 1
Platz 1
Donald Duck / Uncle Scrooge
Viele Titel der Speedline Top100-Liste wurden kontrovers diskutiert, die Nummer Eins blieb jedoch immer unbestritten: Das Siegerpodest gebĂŒhrt Carl Barks fĂŒr seine Geschichten aus Entenhausen. Zwischen 1943 und 1967 schuf Barks in einem Gesamtwerk von 7.800 Seiten eine Vielzahl faszinierender, unterhaltsamer, abenteuerlicher und humorvoller Geschichten. Kristallisationspunkt des Barksschen Kosmos war Donald Duck, der erstmals 1934 in Walt Disneys Kurztrickfilm "The wise little Hen" aufgetreten war. Unter Barks Feder wuchs Donald aus der eindimensionalen Figur der Zeichentrickfilme und Zeitungsstrips zur realen Person heran: Ewig im Kampf mit einer widrigen Umwelt, den TĂŒcken der Technik, der unerbittlichen Natur und den Launen seiner Mitmenschen. Donald ist kein Held, er ist einfach nur eine Ente wie Du und ich, er ist die Ente in uns allen. Ihm zur Seite stehen seine drei Neffen Tick, Trick und Track, die ihn mit ihrer Cleverness und ihrem Pfadfinderhandbuch aus (fast) jeder Bredouille hauen. Barks eigene Erfindung ist der FantastilliardĂ€r Dagobert Duck, der sich vom habgierigen Geizhals zum unternehmungslustigen Abenterer mausert - und Jahre spĂ€ter George Lucas nach dessen eigenem Bekunden als Vorbild fĂŒr Indiana Jones dienen sollte. Gustav Gans, Daisy Duck, Daniel DĂŒsentrieb, die Panzerknacker... die Barksschen Geschöpfe sind weltweit bekannt. Barks Gesamtwerk besteht aus zwei Teilen: Die kurzen Zehnseiter, erschienen in "Walt DisneyÂŽs Comics & Stories", sind Gag-getrieben Geschichten, zu Beginn noch im Stil der Disney-Zeichenrickfilme, die zumeist Donalds Kampf als Erziehungsberechtigter gegen seine aufsĂ€ssigen (und ihm zumeist ĂŒberlegenen) Neffen Tick, Trick & Track thematisieren. Neuland betrat Barks mit den bis zu 30seitigen Abenteuergeschichten in "Donald Duck" und "Uncle Scrooge", in denen die Ducks Abenteuer auf der ganzen Welt erleben, hĂ€ufig auf der Jagd nach mythischen SchĂ€tzen und alten Legenden. In diesen Geschichten entfaltet Barks sein ganzes Können als Autor: Er ist ein groĂer GeschichtenerzĂ€hler in alter Tradition. Barks Zeichnungen sind geprĂ€gt von seinem sicheren GespĂŒr fĂŒr den ErzĂ€hlfluss, sie werden niemals dominierend, denn im Vordergrund stehen die Figuren, ihre Gedanken und Emotionen. Wie kein zweiter kann Barks seine Charaktere GefĂŒhle mit einem einzigen Blick, einer Körperhaltung, einer Geste ausdrĂŒcken lassen. DarĂŒber hinaus nutzt er gekonnt Silhouetten, witzige Hintergrund-Details, Slapstick-Elemente und halpseitige Splash-Panels. Barks Werk wird nach wie vor weltweit publiziert, ist aber in Europa erheblich populĂ€rer als im Ursprungsland Amerika. Der Erfolg in Deutschland, der u.a. zur wunderschönen Werkausgabe der "Barks Library" gefĂŒhrt hat, ist in nicht unerheblichen MaĂe auf die kongeniale Ăbersetzung von Erika Fuchs zurĂŒckzufĂŒhren. Zahlreiche ihrer Kreationen ("Dem Ingenieur ist nichts zu schwör") haben Eingang in unsere Alltagssprache gefunden. Die tiefe Menschlichkeit der Barksschen Kreationen, seine Liebe zum Fabulieren, seine handwerkliche Meisterschaft, der herzerwĂ€rmende Optimismus kombiniert mit einem nĂŒchternen Zynismus: Barks Werk spricht jeden an. Wie wir alle hat auch Carl Barks weniger gute Tage gehabt, aber an seinen guten Tagen hat er Geschichten erzĂ€hlt, deren Perfektion auch beim hundertsten Lesen atemberaubend ist. (Cord Wiljes) Lesetipps:
 Platz 2
Platz 2
From Hell
Ein Mörderteil: 500 Seiten starring Jack the Ripper, Queen Victoria, ein Bastard-Kind der Royal-Family, Huren, Polizisten, Kirchen, Obelisken und Freimaurer. Plus William Morris, William Blake, William Butler Yeats, John (Elefantenmensch) Merrick, dem ungeborenen Adolf Hitler. Und Handys. Der Mörder ist der Leibarzt der Königin, davon geht Moore aus. Ob Sir William Gull wirklich der TĂ€ter war, ist ihm egal, darum geht es nicht. Es geht um die Wirkung der Morde quer durch die englische Gesellschaft und die Folgen fĂŒr die Zukunft, fĂŒr die Gestalt des 20. Jahrhunderts an sich. Aber es ist keine trockene soziologisch/historische Abhandlung. From Hell ist eine Horror-Geschichte mit gigantischem, apokalyptischem Ăberbau, eine Horrorgeschichte, die es nicht bei einzelnen, blutigen Vorkommnissen belĂ€sst (und mit der Verbrennung des Bösen Erleichterung und Nachtschlaf verschafft), sondern nichts weniger will als die individuelle Weltsicht des Lesers zu erschĂŒttern. Moores Methode ist dabei so einfach wie entwaffnend: Er prĂ€sentiert eine erschlagende Anzahl von Fakten und mischt magische/mystische/ mythische/esoterische (wie immer man gerne möchte) Details dazwischen, die ZusammenhĂ€nge herstellen, die man so vorher nicht gesehen hat. Denn wenn so viel wahr ist, warum dann nicht auch dies? Und das auch? So werden gehĂ€ufte ZufĂ€lle zu einem Plan und der Ziel des Plans kann nur grauenhaft sein. Es gibt mehrere Stellen in diesem Werk, an dem man sich wie der Kutscher am Ende des monumentalen 4. Kapitels ĂŒbergeben möchte. Weil einen die Erkenntnis oder das Grauen ĂŒberwĂ€ltigt. (Kann man etwas groĂartigers ĂŒber die GĂŒte eines Buches sagen?) Nicht zuletzt die akribische Darstellung des letzten Mordes (Kapitel 10), bei dem einem wirklich der Boden unter den FĂŒĂen wegbricht. Und das hat nicht, nichts, nichts mit Splatter zu tun, da ist schon Eddie Campbells absolut zurĂŒckhaltender, aber sagenhaft prĂ€ziser Stil davor. Was einen umwirft ist die BanalitĂ€t, der schiere Irrwitz der Metzgerarbeit auf der einen Seite und die Wirkung dieses Irrsinns, die man bis in die Gegenwart spĂŒrt, auf der anderen. From Hell ist eine der wenigen, echten GroĂformen im Medium Comic. Kein Werk, das mehr oder weniger zufĂ€llig ĂŒber die Jahre durch eine Verkettung von Episoden (sprich: Einzel-Alben) umfangreich und komplexer wurde oder einfach durch die erzĂ€hlerische Form in die Breite geht (Stichwort: Manga), sondern das von Anfang an komplett und in aller Vielschichtigkeit geplant war. Ein Werk, das dem Umfang Rechnung trĂ€gt, weil weniger einfach nicht möglich war. Mr. Moore, Mr. Campbell â Hut ab!! (Bernd Kronsbein) Lesetipps:
 Platz 3
Platz 3
Tim und Struppi / Tintin
Haddock - so nennen wir einen reichen KapitĂ€n a.D. im besten Mannesalter - Haddock hatte in Bienleins Rosengarten die schönste Stunde eines Mainachmittags zugebracht, um sich frisch erhaltenen Loch Lomond hinter die Binde zu kippen. Sein GeschĂ€ft war eben vollendet; er stellte das Glas an die Seite und betrachtete die leere Flasche mit VergnĂŒgen, als Professor Bienlein hinzutrat und sich an dem teilnehmenden FleiĂe des KapitĂ€ns ergetzte. âHast du die Castafiore nicht gesehen?â fragte Haddock, indem er sich weiterzurollen anschickte. âWie? Du kannst die Anspielung nicht verstehen?â versetzte der Professor, âSeltsam, dabei ist es doch ganz offensichtlich...â Genau, denn meiner Meinung nach haben das Tim & Struppie-Album âDie Juwelen der SĂ€ngerinâ (1963) und Goethes âWahlverwandschaftenâ (1809), die ich gerade so free & easy miteinander vermixt habe, nicht nur Schauplatz (Landgut bzw. SchloĂ mit groĂem Garten bzw. Park) und Thema (Liebe, Spazierengehen & Metaebene) gemeinsam, sondern sind sich auch in dem Punkt einig, dass ein zentraler Aspekt von Kunst die PrĂ€sentation von Abgehangenheit zu sein hat. Abgehangenheit, die in Wahrheit jedoch megakompliziert ist und nur auf der Grundlage von langen theoretischen Forschungen und endlosen praktischen Versuchen in dieser obercoolen Jenseits-von-Gut-und-Böse-Form delivert werden kann. Das muss man sich mal klarmachen: Herge und Goethe - zum Zeitpunkt der Entstehung dieser Werke lĂ€ngst nicht mehr im besten Mannesalter - vermitteln hier das GefĂŒhl, dass Reden und Umhergehen die geilste Dinge auf der ganze Welt sind. Also wenn ichâs mir recht ĂŒberlege, kann ichâs kaum noch erwarten endlich 60 zu werden. (Marc SagemĂŒller) Lesetipps:
 Platz 4
Platz 4
Asterix
Mit "Asterix" ist es das gleiche wie mit "Monty Phyton": Da stehen total viele Schwachmaten, die dann auch meist jeden Obelix-Flachwitz im Schlaf aufsagen können, drauf. AuĂerdem sind die 24 von Rene Goscinny getexteten BĂ€nde so mit das BildungsbĂŒrgerlichste (MentalitĂ€tswitze, historische Details, Anspielung und Lateiner-SprĂŒche bis der Arzt kommt und wieder geht), was es innerhalb dieses verfluchten Mediums zu bekommen gibt. Nicht umsonst wird immer dann heftig mit Asterix-Heften rumgewedelt, wenn es darum geht, die geforderten Beweise fĂŒr den kulturellen Wert von Comics zu bringen. Und ĂŒberhaupt, dieses ganze "die Kleinen erfreuen sich an den Keilereien und die GroĂen an dem hintersinnigen Wortwitz"-Gerede... schrecklich! Lese ich allerdings "Asterix als LegionĂ€r", "Asterix und der Avernerschild", "Tour de France", "Asterix und Kleopatra", "Asterix und der Kupferkessel", "Die golden Sichel", "Asterix auf Korsika" und "Asterix bei den Schweizern", ist mir das sowas von scheiĂegal, dass kann ich gar nicht in Worte fassen. Rene, du bist der GröĂte und uns allen eine NasenlĂ€nge voraus! (Marc SagemĂŒller) Lesetipps:
Leseproben:
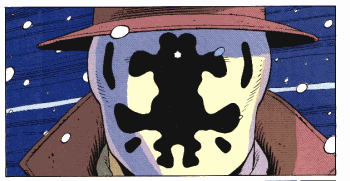 Platz 5
Platz 5
Watchmen
Was hat dieser bĂ€rtige Brite nicht schon alles geschrieben: V for Vendetta, From Hell (jĂŒngst abgeschlossen) und dazu noch Watchmen, die graphic novel (man glaubt fast, fĂŒr Watchmen wurde diese Betitelung erfunden), ohne die wir vielleicht gar nicht mehr hier wĂ€ren; allesamt Medium-Refresher ohnegleichen. Alan Moore ist fraglos der mit Abstand wichtigste unter den lebenden anglo-amerikanischen Comicautoren, und nicht wenige Comicrezipienten hörten oder Ă€uĂersten schon mal das sinngemĂ€Ăe Statement: âMit Comiclesen habÂŽ ich ja wieder ernsthaft angefangen, als Frank Miller mit The Dark Knight Returns und Alan Moore und Dave Gibbons mit Watchmen Mitte der Achtziger gezeigt haben, wie gut, erwachsen, anspruchsvoll und...â. TatsĂ€chlich Ă€hnelt die Watchmen-LektĂŒre einer groĂen Initiation, einer Eiswasserdusche sowohl auf Seiten der Leseerfahrung als auch der Comicschaffenden. StĂ€rker als das Telefonbuch einer gröĂeren Kleinstadt ist diese elegische Superhelden-Symphonie unerreichter Zenit innerhalb des âWas wĂ€re, wenn es Superhelden wirklich gĂ€beâ- Diskurses und markiert die Grenzen dessen, was im Mainstream-Comic möglich scheint. Es ist unmöglich, nach einmaliger LektĂŒre die ganze FĂŒlle dieses GroĂwerks auszukosten; zu genau ist alles durchkomponiert, zu ĂŒberreichlich die (graphischen) Details. Verschiedene Variationen heldischer Moral bzw. Motivation werden an verschiedenen Maskierten durchprobiert, bis als letzte Konsequenz nur der Ausweg in ethisch nicht mehr einholbares, ĂŒber-menschliches Nichts bleibt. (Sven-Eric Wehmeyer) Lesetipps:
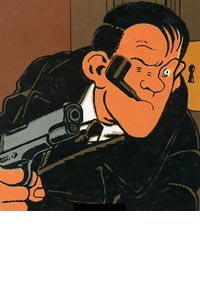 Platz 6
Platz 6
Nestor Burma
Frage: Der gröĂte noch tĂ€tige ComickĂŒnstler ist? Antwort: Jacques Tardi, wer sonst? Kaum ein anderer Zeichner ist so unverkennbar und originĂ€r; kaum ein anderer so stilistisch ausgereift, sicher und makellos; kaum einer so vorzeigbar selbst Comic-Gegnern; fast niemand so durchdacht und kĂŒnstlerisch, ohne sichtbar angestrengt konzeptuell-formalen Auflagen zu folgen. SchlĂ€gt man einen Tardi-Comic auf, ist das wie ein rundum perfekt ausgepolstertes Ă€sthetisches Nest, in das man bedenkenlos fallen kann, ohne auch nur mit den kleinsten Unbequemlichkeiten rechnen zu mĂŒssen. Von seinen frĂŒhesten Arbeiten an (seit Anfang der Siebziger), seit spĂ€testens Der DĂ€mon im Eis (Dargaud 1974; dt.: Ed. Moderne 1991) bis zum frischesten Werk Adeles ungewöhnliche Abenteuer Bd.9: Das Geheimnis der Tiefe (Casterman 1998; dt.: Ed. Moderne 1999) ist nahezu jedes Album ohne Abstriche gigantisch, und wenn fĂŒr diese Hunderterliste Tardis Adaptionen der Kriminal- und Parisromane um den Privatdetektiv Nestor Burma von LĂ©o Malet gewĂ€hlt wurden, hat das etwas WillkĂŒrliches - einen Platz in diesen Charts hĂ€tte z.B. auch seine Adele-Serie locker verdient. Andererseits zeigen die bislang drei Nestor-Burma-Folgen Die BrĂŒcke im Nebel, Kein Ticket fĂŒr den Tod und das fast 200seitige Doppelalbum 120, Rue de la gare zum einen, dass das Adaptieren fremder literarischer Vorlagen fĂŒr Tardi keinen Akt der EinschrĂ€nkung oder Unterwerfung darstellt, sondern vielmehr die volle Entfaltung seiner Kunst zeitigt - in diesem Punkt ist die Beziehung zwischen Romanvorlage und Comicversion (bei allem Respekt, Monsieur Malet) dem VerhĂ€ltnis von Robert Blochs Psycho und Hitchcocks Verfilmung vergleichbar. Zum anderen bieten Malets Texte den Stoff, auf dem Tardis genuiner Ansatz perfekt fusst: Krieg, Krimi und vor allem Paris sind die eigentlichen Hauptdarsteller, die Tardi in ĂŒppigen Schwarz/Weiss- und Graukompositionen ĂŒber ihren Status als Handlungselement oder Dekor hinaus auf eine Höhe treibt, in der andere Comicschaffende nur selten ĂŒberhaupt atmen können. (Sven-Eric Wehmeyer) Lesetipps:
 Platz 7
Platz 7
Corto Maltese
Wir begegnen Corto Maltese zunĂ€chst im Jahre 1913 im SĂŒdwest-Pazifik, reisen dann mit ihm nach SĂŒdamerika, gelangen schliesslich 1917 mit ihm nach Europa, ein Jahr spĂ€ter nach Afrika, und verfolgen um 1920 seine Spur ĂŒber China bis nach Sibirien. Nach Venedig, der Schweiz und dem Reich Mu plante Hugo Pratt Cortos Tod im spanischen BĂŒrgerkrieg als Abschluss dieser Abenteurerbiographie, starb allerdings vor Realisierung dieser finalen Episode. Mit Corto Maltese hat Pratt einen der im altmodischen Sinn faszinierendsten Charaktere der Comicgeschichte geschaffen, von Ă€hnlichem Facettenreichtum und âEchtheitâ wie etwa Orson WellesÂŽ Charles Foster Kane. Bei aller abgefeimt und ironisch eingearbeiteten Selbstreflexion hinsichtlich des ErzĂ€hlstatus seiner Geschichten lassen einen Corto Maltese - Alben wie die SĂŒdseeballade oder Die Kelten zuallererst die Erfahrung idealsten Lesens zuteil werden: man vergisst, dass man liest; man vergisst, zwischen der Magie der dickgetuschten Zeichnungen, der stimmungsvollen Langsamkeit, in der sie erzĂ€hlen, und den Wundern, Abenteuern und Geheimnissen, die erzĂ€hlt werden, zu trennen. Hierzu Pratt: âIch verstehe unter âErzĂ€hlen könnenâ, auf eine ganz bestimmte Weise erzĂ€hlen zu können: Neugierde zu wecken, das Zuhören zur Freude machen, zu fesseln. Es gibt Leute, die diese Gabe besitzen. Ob sie nun die Wahrheit sagen oder lĂŒgen, stets erregen sie Aufmerksamkeit und halten das Publikum in Atem, und zwar mit dieser speziellen Kunst, Zweifel zu wecken, so dass ihr Werk ganz und gar erfunden scheint, einzig zur Unterhaltung geschaffen.â (Sven-Eric Wehmeyer) Lesetipps:
 Platz 8
Platz 8
Maus
Wie sich einem so singulĂ€ren Werk wie Art Spiegelmans âMausâ nĂ€hern? Einer ErzĂ€hlung, wie sie unbedingt notwendig war, von der aber niemand geglaubt hĂ€tte, daĂ es so etwas geben könnte, bis sie erschien? Heftig wurde zum Beispiel darĂŒber debattiert, ob die Form angebracht sei - eine Tierfabel, mit Figuren, wie man sie sonst nur aus Funny Animal Comics Ă la Micky Maus kennt. Ein Nebendiskurs, der eine Erörterung eigentlich nur lohnte, um die weit gröĂere Verstörung in Worte zu fassen, die der ErzĂ€hlgegenstand auslöst. Selbst wer mit der Thematisierung des Holocausts schon eine gewisse Erfahrung hat, wird sich GefĂŒhlen des Entsetzens, der ErschĂŒtterung und letztlich der Trauer nicht entziehen können, die diese âGeschichte eines Ăberlebendenâ weckt. Das liegt nicht zuletzt daran, daĂ der ursprĂŒnglich aus Polen stammende Jude Wladek Spiegelman, Art Spiegelmans Vater, alles andere als ein typischer Held ist. Ein altes, wohl zynisches Bonmot sagt, die Geschichte stĂŒnde immer auf seiten der Sieger. So neigt man leicht dazu, Holocaust-Ăberlebende letztlich doch fĂŒr Gewinner zu halten - die Historie hat ihnen schlieĂlich recht gegeben. Und unter anderen UmstĂ€nden wĂ€re man durchaus geneigt, Wladek fĂŒr einen Siegertypen zu halten - schon vor dem Krieg geht er seinen gesellschaftlichen Aufstieg umsichtig, zielstrebig und bisweilen vielleicht skrupellos an. Eigenschaften, die ihm das Ăberleben im Ghetto, im Untergrund und schlieĂlich im Lager ermöglichen werden. Aber solche MaĂstĂ€be gelten nichts im KZ, erst recht nicht, wenn auch menschliche Regungen wie Anteilnahme, MitgefĂŒhl und Liebe im Spiel sind. Wladek hat ĂŒberlebt. Aber er hat unmenschlich gelitten. Und aller Umsicht, Mut und Verantwortungsbereitschaft zum Trotz hatte er am Ende doch bloĂ - GlĂŒck. Ein in diesem Kontext zweifelhafter Begriff. Denn nicht nur das Lager, auch das Ăberleben hat tiefe Spuren hinterlassen. Zum Zeitpunkt seiner ErzĂ€hlungen ist er ein alter, schwerkranker Mann und penibel bis zur Schrulligkeit. Sein Sohn Art, der die Erinnerungen erst auf Tonband aufzeichnet und dann in einem langwierigen, mĂŒhevollen ProzeĂ der Aneignung zu Papier bringt, hĂ€lt es schwer aus bei ihm, der in seinem Verhalten stets schwankt zwischen Zuneigung und kauziger Vereinnahmung und ansonsten mit seinen Marotten jeden in seiner Umgebung schier um den Verstand bringen kann. Mit manischem Eifer achtet er darauf, nur ja nichts auch nur halbwegs Brauchbares zu vergeuden, und seine Knauserigkeit ist immer wieder AnlaĂ fĂŒr Streit. Aber seine Lagererfahrungen haben ihn ein fĂŒr alle mal gelehrt, stets auf eine Katastrophe gefaĂt zu sein. FĂŒr ihn hat es so was wie Frieden seither anscheinend nie mehr wirklich gegeben. Es erscheint auch fast wie ein Wunder, daĂ nicht nur Wladek, sondern ebenso seine Ehefrau Anja Auschwitz ĂŒberleben konnten. Bis zu ihrer Verbringung ins Lager konnte er sie beschĂŒtzen, danach war jeder auf sich gestellt und dem Zufall und der WillkĂŒr ausgeliefert, möglicherweise an einen brutalen KZ-Schergen zu geraten. Schon bald nach Kriegsende fanden sie sich jedoch tatsĂ€chlich wieder und verlieĂen nur wenige Zeit spĂ€ter endgĂŒltig Polen, um ĂŒber Schweden schlieĂlich in die USA zu gelangen. Dort aber beging Anja Spiegelman 1968 Selbstmord, ohne einen erklĂ€renden Hinweis. Es liegt nahe, die GrĂŒnde im nie ĂŒberwunden Holocaust zu suchen. Art Spiegelman hatte 1967 angefangen, erste Underground-Comix zu veröffentlichen. 1972 erschien von ihm âGefangener auf dem Höllenplanetenâ, eine vierseitige Story, in der er den Suizid seiner Mutter thematisiert. Das und noch ein weiterer Dreiseiter namens âMausâ aus demselben Jahr zeigten bereits das Trauma, unter dem die gesamte Familie litt - Art hatte es von seinen Eltern geerbt. Diese Ur-âMausâ-Version, noch viel mehr Funny Animal als die ausgearbeitete Fassung, zeigt zwar einen Vater auf der Bettkante, der seinem gespannt lauschenden Jungen die KZ-Erlebnisse als Gute-Nacht-Geschichte erzĂ€hlt. Die spĂ€teren, langen EinschĂŒbe, in denen Art Spiegelman ausfĂŒhrlich auf die GesprĂ€chsumstĂ€nde eingeht, unter denen die Aufzeichnungen der Berichte seines Vaters entstanden, und sie und sein Vorhaben zudem skrupulös reflektiert, dementieren aber die falsche Idylle. Mehrfach klingt statt dessen an, daĂ diese Erinnerungen wie ein Fluch ĂŒber Arts Kindheit gelegen haben mĂŒssen. Fast zwanzig Jahre hat er schlieĂlich gebraucht, um âMausâ verwirklichen zu können. Und um genĂŒgend Abstand zu gewinnen, damit seinem Vater endlich Gerechtigkeit widerfĂ€hrt. Wladek Spiegelman hatte wohl nie ein Held sein wollen und ist es vielleicht auch gar nicht gewesen - jedenfalls nicht nach Hollywood-MaĂstĂ€ben. Aber er hat ĂŒberlebt. Und das Zeugnis seines Leidens, seines Lebens ist ein groĂes, so erschĂŒtterndes wie ehrfurchtgebietendes Dokument der Menschlichkeit. Unverzichtbar. (Martin Budde) Lesetipps:
 Platz 9
Platz 9
Gaston
Am 28. Februar 1957 erschien er erstmals auf der BildflĂ€che - und stand einfach nur rum. Kein Comic, kein Kommentar, nichts. Wenn es den Anti-Helden im Comic schlechthin gibt, dann ist es Gaston. (Mit Nachnamen ĂŒbrigens Lagaffe, wörtlich: Missgriff, Missgeschick.) Denn als solchen hatte ihn Andre Franquin (1924-97) ausdrĂŒcklich erfunden. WĂ€hrend alle anderen Comic-Figuren der damaligen Zeit noch Woche fĂŒr Woche brav und erfolgreich ihren Abenteuern nachgingen, war Gaston zunĂ€chst nur dazu da, seine Untauglichkeit fĂŒr jede herkömmliche Verwendung unter Beweis zu stellen. Und so fing er schnell an, die redaktionellen Seiten des âSpirouâ-Magazins zu verunsichern bzw. seinen Vorgesetzten Fantasio in dessen Redakteurseigenschaft zu Verzweiflung und WeiĂglut zu treiben. Gaston war anfangs selten mehr als der BĂŒrotrottel und PrĂŒgelknabe. Franquin gab sich mit der Grundidee vollauf zufrieden, das konventionelle Heldenschema durchbrochen zu haben, und der Rest war Klamauk: Wer spielt wem einen Streich? Langsam verschob sich aber der Schwerpunkt aufs âwieâ, und nun konnte Gaston sein Potential allmĂ€hlich entfalten. Mit Phantasie und Beharrlichkeit ging er daran, nach seiner bloĂen Anwesenheit auch seine Interessen durchzusetzen. Dazu gehörten alle Arten von Basteleien, Experimente oder musikalische Exzesse, nur keine geregelte BĂŒrotĂ€tigkeit. Das solcherart provozierte Establishment schlug, hauptsĂ€chlich in Person seines Handlangers Fantasio, hĂ€ufig recht handgreiflich zurĂŒck. Gaston aber quittierte jeden Korrektur- oder Erziehungsversuch mit stoischem Gleichmut. Im ĂŒbrigen durfte man darauf gefasst sein, dass Gastons AktivitĂ€ten und EinfĂ€lle immer wieder absurde Ergebnisse zeitigten. Mitunter genĂŒgte dafĂŒr sein bloĂes Erscheinen, und schon ging es schief. Fehlendes Talent und den Hang zum Missgeschick machte er jedoch durch Enthusiasmus und Engagement mehr als wett. Dass seine Bastelleidenschaft und Experimentierfreude gleichzeitig einen subversiven, ironischen Kommentar zur damals noch allgegenwĂ€rtigen Technikbegeisterung - gerade auch im Comic - darstellten, sei nur am Rande erwĂ€hnt. (Ă€hnliches lieĂ Franquin ja ungefĂ€hr gleichzeitig im Zyklotrop-Zyklus seiner Hauptserie âSpirou und Fantasioâ anklingen.) Man konnte sich aber darauf verlassen: selbst wenn infolgedessen das gesamte BĂŒro in die Luft flog - nie hatte es Gaston böse gemeint. Mit dieser unberechenbaren Mischung aus abstrusen Ideen und unbedarfter GutmĂŒtigkeit hatte Gaston die Redaktion insgeheim schon im Griff. Ihn zur Verantwortung zu ziehen, fruchtete nichts. Stets war er unschuldig wie ein groĂes Kind. Parallel dazu kam Andre Franquin mit âSpirou und Fantasioâ immer schleppender voran. Er empfand diese Serie, die er als junger Spund ohne Erfahrung ĂŒbernommen und zu ungeahnten Höhen gefĂŒhrt hatte, zunehmend als TretmĂŒhle. Die LĂŒcken in ihrem ehedem kontinuierlichen Erscheinen wurden gröĂer, und an ihre Stelle trat - natĂŒrlich Gaston. Ihre vorletzte Episode unter Franquin geriet schon zu einem langen Gaston-Abenteuer, zugleich verdoppelte sich der Umfang von dessen Auftritten zu einer vollen Seite pro Heft. Und schlieĂlich gab Franquin 1968 die Titelserie endgĂŒltig ab, um sich nur noch seinem âBĂŒrobotenâ zu widmen. Nun hatten beide freie Bahn. Auch rĂ€umte der bedauernswerte Fantasio jetzt seinen BĂŒrostuhl, und der Nachfolger Demel war bald nur noch ein nervliches Wrack. LĂ€ngst hatte sich auĂerdem Gastons TĂ€tigkeitsfeld auf die Nachbarschaft ausgedehnt. Und besonders der ewige Kleinkrieg mit Wachtmeister Knösel, dem Herrn der Knöllchen, gab ihm reichlich zu tun - noch ein Vertreter angemaĂter AutoritĂ€t, dem Gaston seine eigene entgegensetzte: ein urwĂŒchsiges Recht auf KreativitĂ€t, ohne einengende Regeln, eine Form des Miteinanders, die nicht von Arbeitszeiten und Parkuhren bestimmt ist. In der 70ern erlebte Gaston seine Hochphase. Seine Ideen wurden immer ausgefeilter ausgefallener und (aber-) witziger - oder die von Franquin. Denn endlich befreit von der ewigen RĂŒcksichtnahme auf bĂŒrgerliche SekundĂ€rtugenden konnte der nun seinem anarchischen Einfallsreichtum die ZĂŒgel schieĂen lassen und seinen schwungvollen Zeichenstil weiter entfalten. Wilde Verfolgungen, abstruse Verkettungen waren jetzt sein Metier und âGastonâ nichts anderes als VitalitĂ€t pur. Der ehedem unbekĂŒmmerte Tolpatsch entwickelte ansatzweise sogar so was wie ökologisches und soziales Bewusstsein - und er begann zarte Bande zu knĂŒpfen zu FrĂ€ulein Trudel, ehedem misogynes MauerblĂŒmchen in der Redaktion. Die Serie rundete sich nun; von der anfĂ€nglichen AuĂenseiterklamotte mit bisweilen denunziatorischen ZĂŒgen hatte sie sich entwickelt zur lustvollen Konfrontation zwischen kraftvollem PhantasieĂŒberschuss und den zwanghaften Verwertungsinteressen der Arbeitswelt, die den Ausblick freigab auf eine anarchische Utopie. Höhe- und Schlusspunkt der Auseinandersetzung war ein fulminanter FuĂtritt fĂŒr BruchmĂŒller, den cholerischen Vertreter des Kapitals. Dieser einmalige tĂ€tliche Angriff war ein Warnzeichen, dass sich der Konflikt nur noch mit MĂŒhe im Zaum halten lieĂ. LĂ€ngst hatte sich auch in Franquins Stil eine forcierte Anspannung eingeschlichen, bis zum Bersten angefĂŒllt mit unterschwelliger NervositĂ€t. Zwischenzeitlich hatte er sich ein Ventil verschafft mit den âSchwarzen Gedankenâ, in denen er alle möglichen Formen alltĂ€glichen Irrsinns, vor allem gesellschaftliches Fehlverhalten, scharf karikierte, mit akribischer Wut und bissigem, schwarzem Humor. Doch fĂŒr eine solche AggressivitĂ€t war in âGastonâ kein Platz. Dessen subversive AnschlĂ€ge auf die Arbeitsmoral hatten freundlich und arglos zu bleiben. Diese Anspannung entlud sich in einer persönlichen Katastrophe. Franquin verfiel einer manifesten Depression, die jede weitere Arbeit blockierte. In den 80er Jahren war es ihm weitestgehend unmöglich zu zeichnen, und als er sich Anfang der 90er Gaston noch einmal fĂŒr einige Strips vornahm, war diese alte, treibende, schlieĂlich aber zerstörende Kraft verschwunden. Den letzten âGastonâ-Seiten sieht man an, wie vorsichtig, behutsam sie realisiert wurden. NatĂŒrlich war seine Gesundheit ein zu hoher Preis. Aber Andre Franquin war in aller Bescheidenheit nie in der Lage, weniger als alles zu geben, wozu er fĂ€hig war, und hat sein Limit dabei immer weiter voran getrieben. Entstanden ist auf diese Art ein klarer Beweis, dass auch eine scheinbar kleine Form zu groĂer Meisterschaft taugt. Mehr noch: âGastonâ ist ein Kunstwerk, das sich nie als solches verstand - gerade deshalb. (Martin Budde) Lesetipps:
Leseproben:
 Platz 10
Platz 10
Batman: The Dark Knight Returns
Was fĂŒr ein GefĂŒhl muĂ es wohl sein, etwas losgetreten zu haben, das einen kompletten Markt umkrempelte, was sich fĂŒr immer in das Gesicht eines ganzen Medienzweigs gebrannt hat? Man könnte das zum Beispiel Frank Miller fragen⊠Er hatte schon einiges auf dem Kerbholz gehabt. Unter seinen HĂ€nden war Anfang der achtziger die ausgelutschte Figur des "Daredevil" unerwartet zum Kult mutiert, "Elektra Assassin" hatte auf mehreren Ebenen neue MaĂstĂ€be gesetzt, fĂŒr "Ronin" hatte er den höchsten VorschuĂ abgesahnt, der je fĂŒr ein Comic gezahlt worden war. Nach all dieser Publicity-trĂ€chtigen Vorarbeit war klar, daĂ seine nĂ€chste Arbeit nicht als Insidertip den Markt betreten wĂŒrde: Die Batman-Story "The Dark Knight" erschien 1986 und schlug ein wie eine Atombombe. Die Kritiker ĂŒberboten sich mit Komplimenten, die Szene kriegte vor Staunen den Mund nicht mehr zu, die Auflagenzahlen zauberten ein sehr zufriedenes LĂ€cheln auf die Gesichter der DC-Bosse, und dann geschah etwas, das kaum ein Comic je hinkriegt: Batman wurde von einer Comicfigur zu einem gesellschaftlichen Ereignis. Die Zeitungen riefen das Jahr des Batman aus, sofort trat Hollywood auf den Plan, und durch Tim Burton, der "Batman the Movie" von Anfang an als Merchandising-Monster und Giga-Blockbuster konzipiert hatte, erfuhren sehr bald auch Leute von der Existenz des dunklen Ritters, die noch nie ein Comic von innen gesehen hatten. Das Fledermaus-Logo klebte sehr bald auf allem, was es gibt, und nie zuvor rannten soviele Leute mit Batman-T-Shirt durch die Gegend. Was aber das erstaunlichste an all diesen Entwicklungen war, war die Tatsache, daĂ hier etwas in den Olymp gehyped wurde, das es tatsĂ€chlich verdient hatte. Dieser Comic war nicht bloĂ angeblich eine Revolution - er war wirklich eine. Was an "The Dark Knight" so schockierte, war die rigorose Ernsthaftigkeit, mit der da jemand eine Geschichte ĂŒber einen Typen im FledermauskostĂŒm erzĂ€hlte. In einer noch nie zuvor gesehenen Hektik drosch da eine durch und durch mit Gewalt und Zynismus aufgeladene Story auf den Leser ein, die auch noch lustvoll in allen wunden Punkten der Psyche des Endachtziger-Reagan-Amerikas herumbohrte - keine nette oder gar besinnliche Unterhaltungsware, hier wurde scharf geschossen. Miller hatte wie kaum jemand zuvor erkannt, was fĂŒr ein Symbolpotential in der Figur des Batman steckte. Batman war schon immer ein Charakter gewesen, der sich im Gegensatz zu seinem sauberen und braven "groĂen Bruder" Superman mit dem Dreck, der Nacht, den Schattenseiten, dem Wahnsinn auseinandersetzen muĂte. So machte Miller seinen "Dark Knight" zu einem Politikum, einer Tour de Force durch all die negativen Seiten der Gesellschaft, die sich mit biestigen Kommentaren nicht zurĂŒckhielt, ganz gleich ob ĂŒber Medien, Gewalt in den StraĂen, Selbstjustiz, Gesetz und Ordnung oder nukleare KriegsfĂŒhrung. Und als Kirsche auf den Kuchen lieĂ er den Jahre vorher schon arg in die Credibility-Gosse geratenen Batman zu einem neuen, fantastischen Glanz erblĂŒhen - indem er das Ende des Helden erzĂ€hlte, setzte er ihm die Krone einer Mythenfigur auf. Ăber die genauere Handlung des ganzen soll hier gar nicht erst ein Wort verloren werden - wenn man irgendeinen Superhelden-Comic der letzten zwanzig Jahre gelesen haben sollte, dann diesen; am besten im Original, um sich direkt von Millers grandioser Macho-Sprache in die Fresse hauen zu lassen. Ach ja: Bedauerlicherweise, ganz ganz bedauerlicherweise hat Miller sich jetzt dazu ködern lassen, einen Teil zwei in die Welt zu setzen. Gemunkelt wird von einer beknackten Story, in der alle Helden die Welt verlassen haben und Batman auszieht, sie zu finden. Es wird grauenvoll werden, egal wie es wird. Wieder einer, der fĂŒr eine groteske Gage seine Seele verkauft. Frank, was hĂ€tte Dein Batman aus dem ersten Teil zu einer solchen Morallosigkeit gesagt? Du wĂŒrdest in diesem Augenblick mit dem Kopf nach unten an den Gotham Twin Towers baumeln. (Thomas StrauĂ) Lesetipps:
 Platz 11
Platz 11
ACME Novelty Library
Welch ein Wirrwarr. Jeder Versuch, die âACME Novelty Libraryâ von Chris Ware - im Herbst 1993 begonnen und im FrĂŒhjahr 2000 (vorlĂ€ufig) abgeschlossen - in eine vernĂŒnftige Reihung zu bringen, ist ein zeitraubendes Unterfangen. Wechselnder Umfang und kraĂ unterschiedliche Formate - von kleinen, querformatigen BroschĂŒren bis zum riesengroĂen Heft im Zeitungsformat - sowie eine mitunter kaum auszumachende, vertrackte Numerierung machen es einem nahezu unmöglich, die insgesamt vierzehn BĂ€nde sauber in einem Regal oder sonstwo unterzubringen. Auf den ersten Blick faszinierend ist allerdings das altmodische, ornamentĂŒberladene Design jedes einzelnen Titels, das immer wieder anders den Stil der Versandhauskataloge, Werbezettel und Pulphefte zu Beginn des (20.) Jahrhunderts imitiert. Eine gedrĂ€ngte FĂŒlle an Schnörkeln, Vignetten, SchriftzĂŒgen und hochgestochenen, aber mikroskopisch kleinen ReklamesprĂŒchen fesselt und irritiert zugleich die Aufmerksamkeit. Dagegen besticht die Graphik des Inhalts zunĂ€chst mit wohltuender Klarheit - bis bei nĂ€herem Hinsehen deutlich wird, daĂ auch hier ein alles durchdringendes graphisches Konzept scheinbar spielerisch, in Wahrheit aber eisern zahllose disparate Einzelteile zusammenhĂ€lt, ohne daĂ sie unmittelbar miteinander in Beziehung stĂŒnden. In diesem Sammelsurium aus kurzen, cartoonesken Strips, Comic-Episoden, Illustrationen, Diagrammen, Heften im Heft, gefaketen (Klein-) Anzeigenseiten und noch manches mehr gibt es dennoch so was wie einen massiven, inhaltlichen Kern, einen ErzĂ€hlfaden, so verschlungen der sich auch abwickeln mag. Mehr als die HĂ€lfte der Hefte, nĂ€mlich acht Ausgaben, sind unmittelbar einer einzigen Story zuzuordnen: der von âJimmy Corrigan, The Smartest Kid On Earthâ (und dazu kommen mindestens noch zwei, die frĂŒhe Versionen enthalten). Der Titel ist ein blanker Euphemismus, eine groĂzĂŒgige, marktschreierische Ăbertreibung, denn dieser J.C. ist weder Kid noch smart. TatsĂ€chlich ist er ein farbloser, 36jĂ€hriger Sonderling - Angestellter in einem GroĂraumbĂŒro, ein Muttersöhnchen, furchtbar introvertiert, den eine Aura herzzerreiĂender Einsamkeit umweht. Sein zutiefst banales, belangloses Dasein schildert Chris Ware in quĂ€lend ereignisarmen Momentaufnahmen und absurden TagtrĂ€umen, in denen sich sein Protagonist etwa als altertĂŒmlicher BlechbĂŒchsenroboter sieht - rundum gepanzert - oder als Sci-Fi-Wunderkind, âThe Smartest Kid On Earthâ eben, Pulp-Abenteuer erlebt. Jimmy Corrigans LebensuntĂŒchtigkeit, seine UnfĂ€higkeit zur Kommunikation wurzeln in einer vaterlosen Kindheit. Das geht aus kurzen EinschĂŒben hervor, die ihn als introvertierten Knaben zeigen, dessen Wahrnehmung die (erwachsene) Wirklichkeit glatt unterlĂ€uft. So nimmt seine Geschichte urplötzlich Fahrt auf, als ihn sein verschollener Vater eines Tages bittet, ihn zu besuchen. Diese Begegnung trĂ€gt alle ZĂŒge eines Fiaskos, denn weder der gutmeinende, aber von SchuldgefĂŒhlen geplagte Vater, noch der emotional hilflose und insgeheim von gewalttĂ€tigen Rachephantasien verfolgte Sohn kommen mit der Situation einigermaĂen klar. Der eine flĂŒchtet sich in belangloses Geplauder, der andere in das, was er am ehesten kann: verwirrtes Schweigen. Dennoch geraten die VerhĂ€ltnisse ĂŒber die Dauer von Jimmys Anwesenheit - insgesamt nur wenige Tage - langsam, aber unaufhaltsam in Bewegung. Eingeschoben wird auĂerdem die Geschichte seines GroĂvaters, der als Kind ein Ă€hnliches Schicksal erlitt - das bis dahin kohĂ€renteste Kapitel der mĂ€andernden ErzĂ€hlung. Es scheint fast, als wĂ€re der frĂŒhe Elternverlust so etwas wie der Fluch dieser Familie. Und dann ĂŒberschlagen sich die Ereignisse: Jimmy reist schlieĂlich ĂŒberstĂŒrzt ab, zutiefst verstört. Nur, auch daheim in Chicago hat sich manches verĂ€ndert. So besteht schlieĂlich die vage Aussicht, daĂ er aus seinem trostlosen Kokon doch noch herausfindet - ein FĂŒnkchen Hoffnung, mehr nicht, aber immerhin... Bleibt die Frage nach der Einbettung von Chris Wares tragischem Anti-Helden in diesen prĂ€tentiösen ACME-Kontext, der einen auffĂ€lligen Kontrast zur inneren Leere schafft, die seinen Jimmy Corrigan lĂ€hmt. Die aufwendige Ausstattung, das ĂŒberbordende Design , all das wirkt nur scheinbar widersinnig. In Wahrheit folgt es dem Gestaltungsprinzip des Horror vacui, zu ĂŒbersetzen mit panischer Angst vor der Leere - et voilĂ , da hĂ€tten wir den inneren Zusammenhang. EndgĂŒltig offenbar wird das, wenn man das Kleingedruckte der Pseudo-Anzeigen zum Beispiel wirklich liest: geworben wird da keineswegs fĂŒr âwitzigenâ Schnickschnack, sondern fĂŒr lebenslange Komplexe, Instant-SchuldgefĂŒhle oder perfide RachegelĂŒste. Eine boshafte Revanche fĂŒr all die billigen Ersatzbefriedigungen, die frĂŒher ĂŒber solcherart aufgemachte Inserate an ahnungslose, wunderglĂ€ubige Kinder vertickt wurden. Oder die zahlreichen, akribischen Bastelbögen, die fast jeden ACME-Band zieren: mit ihnen lassen sich Ersatzwelten schaffen, kleine Figuren und Dioramen nach Motiven der Geschichten, die ja an sich ganz niedlich sind und auch garantiert funktionieren. Nur können sie im Zweifelsfall wirklich ĂŒber ein ungelebtes Leben hinweg trösten? Und was ist davon zu halten, wenn eine der peniblen, jovialen Bastelanleitungen den Tip gibt, bei aufkommenden Schwierigkeiten einen Erwachsenen um Hilfe zu bitten, darĂŒber aber unversehens völlig aus dem Ruder lĂ€uft und selbst zu einem einzigen Hilfeschrei nach dem abwesenden Vater mutiert? Keine Frage: die âACME Novelty Libraryâ ist ein ausgetĂŒfteltes, vielschichtiges und durchkomponiertes GroĂunternehmen, beseelt von einem ungeheuren Gestaltungswillen, vor allem aber von einem zentralen Anliegen, das sich massiv, mit aller Wucht auf sĂ€mtlichen Ebenen und in jedweder Form Bahn bricht. Unnötig zu erwĂ€hnen, daĂ auch die scheinbar humoristischen Strips, die den Rest der Library ausmachen, in Wahrheit todtraurige Geschichten von Verlust-, Versagens- und Versagungsangst sind. Was so geschmĂ€cklerisch daherkommt, ist somit ein emotional höchst aufwĂŒhlendes Opus magnum, das einen beinah erschlĂ€gt, so bald man sich nĂ€her darauf einlĂ€Ăt. Wer sich diesem beispiellosen Comic-Monument nĂ€hert, sollte darauf gefaĂt sein, mehr zu bekommen, als er jemals verlangt hat. (Martin Budde) Lesetipps:
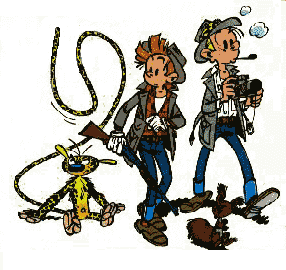 Platz 12
Platz 12
Spirou & Fantasio
Franquins Version des Hotelpagen Spirou verhĂ€lt sich zu "Tim und Struppi" wie John Lennon zu Beethoven oder sagen wir besser wie Nietzsche zu Hegel. HandlungsstrĂ€nge werden einfach fallengelassen, Ideen (ohne sie groĂ auf ihre QualitĂ€t hin zu testen) kurzerhand eingebaut, Slapstickeinlagen, die manchmal ĂŒberhaupt nicht lustig sind, auf Kosten der Story in die LĂ€nge gezogen, vom Verleger genormte Seitenzahlen ĂŒber- und unterboten, Abenteuer abrupt abgebrochen, Kollegen zur Fertigstellung von Alben zu Hilfe gerufen, kurz: es wird alles getan, um soetwas wie KohĂ€renz gar nicht erst auch nur im Ansatz aufkommen zu lassen. Daher ist Andre Franquins Spirou-Run (die Figur hatte Rob Velter in den spĂ€ten DreiĂigern erfunden) wahrscheinlich auch der einzige klassische Abenteuer/Funny-Comic, der in Aphorismen erzĂ€hlt ist. Bis das von Depressionen geplagte Genie dies jedoch bemerkte und deshalb auf die diesem Prinzip (zumindest aus kulturindustrieller Sicht) nĂ€herstehende Onepager-Serie "Gaston" umstieg, hatte er bereits Material fĂŒr satte 17 Alben (die ersten Gehversuche mal nicht eingerechnet) fertiggestellt. Check this out: "Der Doppelte Fantasio", "QRN ruft Bretzelburg" und "Schnuller und Zyklostrahlen" (Marc SagemĂŒller) Lesetipps:
Leseproben:
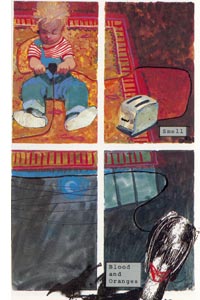 Platz 13
Platz 13
Stray Toasters
Bevor man "Stray Toasters" aufschlĂ€gt, sollte man erst noch ein paar mal tief Luft holen, denn weiteres Atmen wird man fĂŒr die Dauer der LektĂŒre vergessen. Selbst heute noch, 12 Jahre nach seinem Erscheinen, fĂŒhlt man sich beim Betrachten dieses ausschweifenden StilgebrĂ€us, als hĂ€tte jemand einem zwanzig Eimer Farbe ins Gesicht geklatscht. Mit dieser Serie erstrahlte Bill Sienkiewicz Ende der achtziger fĂŒr einen kurzen Augenblick zu einem Jimi Hendrix der Comics â hier war einer, der von A bis Z sein Handwerk beherrschte, kalkuliert explodiert, hatte sich in orgiastischer Schaffenswut den Weg freigezeichnet und dabei so ziemlich jede Regel gebrochen, die dem Begriff âComiczeichnungâ bis dahin innewohnte. Als der frisch von der Designschule entlassene Sienkiwicz Ende der siebziger feststellen muĂte, daĂ die New Yorker Kunstszene Neulinge nicht eben mit offenen Armen zu empfangen pflegt, stieg er zunĂ€chst in die Niederungen der Werbeillustration und der Comics hinab. Mit einem durchtrainierten Stil, der dem Strich vom Marvel-Ikone Neil Adams erstaunlich Ă€hnlich sah, erwarb er sich Respekt als Penciller fĂŒr Serien wie âMoonknightâ und die âFantastic Fourâ. 1985 legte er mit Frank Miller als Szenarist bereits das erste Erdbeben hin: âElektra Assassinâ war einer der ersten groĂen Vertreter des neuen Kreativ-Rausch am Comicmarkt, ein smart abgefaĂter und farbenschreiender Herold einer neuen Welle von Autoren und Zeichnern, die zu jener Zeit aufbrachen, die dröge gewordene US-Comic-Landschaft mit einer grundlegenden Frischzellenkur zu versorgen. In einigen Ausgaben âThe Shadowâ konnte Sienkiewicz seiner Experimentierfreude noch ein wenig schwelen lassen, bis sie in seinem selbstverfaĂten, kruden SciFi-Krimi âStray Toastersâ zur endgĂŒltigen Explosion kam. Worum es geht? Der Teufel macht Urlaub in New York, wĂ€hrend der alkoholkranke Inspektor Egon Rustemagick einen Frauenmord aufklĂ€ren muĂ, der durch einen zum Roboter umfunktionierten Toaster begangen wurde, bei dem ein Kind anwesend war, daĂ von Rustemagicks Ex-Freundin aufgenommen wird, wĂ€hrend ein degenerierter Doktor elektrische KrĂ€hen nach ihm ausschickt, um ihn aus dem Verkehr zu ziehen, bevor... Wer glaubt, daĂ das alles allein schon reichlich wirr wĂ€re, der wird erst recht durch die kreischende Inszenierung gekillt: eingebettet in mehrere ErzĂ€hlperspektiven pfeift einem ein wĂŒster Mix aus Feder, Pinsel, Airbrush, KopiergerĂ€t, Materialcollage und was noch alles um die Ohren â ein designerisches Stahlbad, daĂ bis heute seinesgleichen sucht. Viele haben sich spĂ€ter in so etwas versucht, aber kaum jemand hat dieses Konzept zu so einer Meisterschaft gebracht. âStray Toastersâ markierte den Höhepunkt einer kurzen, glanzvollen Epoche der fieberhaften Innovation, die damals die US-Szene ĂŒberkam und Versprechungen auf eine Zukunft machte, die leider nie wirklich eingelöst wurden. Die Karrieren der damaligen Sturm- und DrangkĂŒnstler wurden spĂ€ter gröĂtenteils in den mauen Superhelden-Mainstream zurĂŒckgesogen, so auch die von Sienkiewicz. Er und seine Mitstreiter waren so weit gegangen, daĂ sich am Ende kaum noch einer traute, ihnen zu folgen, erst recht die Leser nicht. Jammerschade eigentlich. (Thomas StrauĂ) Lesetipps:
 Platz 14
Platz 14
EC New Trend
"The Big If", Johnny Craig, "Mars Is Heaven", TWO-FISTED TALES, Jack Kamen, "F-86 Sabre Jet", CRIME SUSPENSSTORIES, "Bird-Dogs", Reed Crandall, "The Aliens", WEIRD FANTASY, "A Baby", MAD, "The Small Assassin", Graham Ingels, "When The Catâs Away", "The Whipping", Harvey Kurtzman, "The Patriots", THE VAULT OF HORROR, "More Blessed To Give", Al Feldstein, PIRACY, "Shoe Button Eye", SHOCK SUSPENSTORIES, George Evans, "He Walked Among Us", Jack Davis, "Custerâs Last Stand", "The Mole", Joe Orlando, "Pipe-Dream", THE HAUNT OF FEAR, "Mud", Bill Elder, "Rubble", John Severin, "Shermlock Shoes", ACES HIGH, "In The Bag", "There Will Come Soft Rains", FRONTLINE COMBAT, "Seep No More", Marie Severin, "The Tryst", TALES FROM THE CRYPT, "The Night Before Christmas", Wallace Wood, "The Master Race", WEIRD SCIENCE FANTASY, Joe Kubert, "Superduperman", Bernie Krigstein, "Under Cover", Al Williamson, "Plucked", WEIRD SCIENCE, Frank Frazetta, "Atom Bomb", PANIC, "Touch And Go", "Hannibal", Alex Toth, IMPACT, "Dying City"... (Marc SagemĂŒller) Lesetipps:
 Platz 15
Platz 15
Blake & Mortimer
Klarer kann die Linie kaum noch sein. Was Ex-Opernbariton Jacobs mit seiner acht Geschichten umfassenden Reihe um den Scotland-Yard-Inspektor Francis Blake und Professor Philip Mortimer schuf, ist nicht nur Vorzeige-Frankobelgisch, mit einer beinahe perversen zeichnerischen Abgehangenheit, sondern ebenso ein Extrem dessen, was im Medium Comic an synchronem Over- und Understatement ĂŒberhaupt möglich ist. ZunĂ€chst Abenteuer-Stories - Krimi, Science Fiction, Fantasy miteinbringend - , sind Alben wie Das Geheimnis von Atlantis, SOS Meteore und vor allem das berĂŒhmte Gelbe M eigentlich, darin die berufliche Herkunft ihres Schöpfers bestĂ€tigend, reinste Studien in Rhythmus und Harmonie. Zu beinahe ĂŒberirdisch gekonnter Graphik (wer die fĂŒr altmodisch hĂ€lt, werfe einen Blick in Chris Wares ACME Novelty Library und dann einen zurĂŒck zu Jacobs) beschert einem der grandios unverquatschte ErzĂ€hler KĂ€stchentexte wie âMortimer rutscht in den Teich!â, wobei das dazugehörige Panel dankbarerweise zeigt, wie Mortimer in den Teich rutscht. Allein die ersten 20 Seiten von SOS Meteore, die Jacobs damit verbringt, Mortimer den lĂ€ngsten, verwirrtesten und spannungsunaufgeladensten Spaziergang der Comicgeschichte machen zu lassen, sind schieres zweckfreies Pathos und mindestens eine Magisterarbeit wert. (Sven-Eric Wehmeyer) Lesetipps:
Love and Rockets
Zu Beginn der Achtziger war "Love & Rockets" eine Art SF-Soap, die sich durch einen recht heftigen Spiderman-Einschlag auszeichnete (noch heute lassen sich Spuren der beiden zentralen Spiderman-Zeichner der sechziger Jahre, Steve Ditko und John Romita, bei Gilbert und Jamie finden). Da ging es um Liebe und andere Kleinigkeiten unter jungen Raumschiff-Mechanikern (was auch den inzwischen etwas rĂ€tselhaften Titel erklĂ€rt). Das SF-Element wurde jedoch schnell zugunsten zweier sehr realistisch gestalteter Mikrokosmen fallengelassen: einem Vorort bzw. Stadtteil von Los Angeles (Jamie) und dem lateinamerikanischen Kaff Palomar (Gilbert). Diese bevölkerten die GebrĂŒder mit Kleinkriminellen, Bauern, Irren, Punkrockerinnen, Schweinerockern, Dicken, DĂŒnnen, Lesben, Schwulen, Catcherinnen, Homeboys, Homegirls, Deppen, Metallern, Skatern, Auswanderern, Einwanderern etc. (Robert Altman lĂ€sst herzlich grĂŒĂen). Der Motor, der die Serie seitdem am laufen hĂ€lt, ist ein aus der Literatur bekanntes Konzept, welches frĂŒher mal Entwicklungsroman hieĂ und mittlerweile (in Anlehnung an die Filmreihe von Francoise Truffaut) in "Antoine Doinel"-Prinzip umbenannt wurde, da fĂŒhrende Wissenschaftler festgestellt haben, dass so etwas wie Entwicklung im idealistischen und humanistischen Sinne nicht wirklich existiert und es stattdessen nur so ein stĂ€ndiges Hin und Her gibt, das dann am Ende auf den Namen Leben hört. Das mag jetzt vielleicht ein wenig merkwĂŒrdig klingen, bedeutet aber nichts anderes, als dass sich die Figuren zusammen mit der Serie verĂ€ndern und Ă€lter werden. Es ist in diesem Zusammenhang zwar schon ungefĂ€hr 18793 mal erwĂ€hnt worden, ich muss jedoch trotzdem noch ein weiteres mal darauf hinweisen: Maggie Chascarrillo ĂŒber die diversen BĂŒcher hinweg beim Dickerwerden zuzusehen, ist nicht nur schlichtweg grandios, sondern auch bezeichnend dafĂŒr, wie "Love & Rockets" funktioniert. Auch wenn es sicherlich nicht leicht ist, in eine laufende Serie einzusteigen, die beiden bei Reprodukt erschienenen BĂŒcher"Der Tod yon Speedy" (Jamie) und "Das Blut von Palomar" (Gilbert), die den BĂ€nden 7 und 8 der amerikanischen Gesamtausgabe entsprechen, eignen sich hervorragend fĂŒr Interessierte, die feststellen wollen, ob "Love & Rockets" ihr Ding ist. (Marc SagemĂŒller) Lesetipps:
 Platz 17
Platz 17
The Spirit
Sieht man einmal von frĂŒhen Auftragsarbeiten ab, so kann man die Karriere Will Eisners in drei bemerkenswerte Abschnitte aufteilen: Da gibt es seinen Spirit, der sich von 1940 bis 1952 in insgesamt 649 Folgen durch die Sonntags-Supplements amerikanischer Zeitungen kĂ€mpfte, das warmherzige (bösmeinende Menschen sagen auch kitschige) Alterswerk und die theoretischen BĂŒcher, die das Medium erstmals auf kommunikationstheoretische Beine stellte. DaĂ im Comicpantheon einzig der Spirit ĂŒberleben wird, liegt wohl daran, daĂ Eisner Zeit seines Lebens ein hoffnungsloser Romantiker geblieben ist; so ein Mensch hat im Zeitalter von MTV und Serienkillern einfach nichts verloren. Der Spirit jedoch besticht durch weit mehr als pure Nostalgie. Ăhnlich wie Orson Welles die Sprache des Films neu definierte hat Eisner mit seinen Spirit-Stories dem Medium Comic neue Ausdruckformen verliehen. Es sind seine schrĂ€gen Perspektiven, seine meisterhafte Verwendung von Licht und Schatten und schlieĂlich sein perfektes erzĂ€hlerisches Timing, die den Sprit auch heute noch zu einem LesevergnĂŒgen machen. Dabei orientierte er sich weniger am populĂ€ren Medium Film, als vielmehr an der zeitgenössischen Literatur und am Theater. Eisners Figuren agieren auf einer BĂŒhne, deren Hintergrund die amerikanische GroĂstadt ist, und scheinen mitten aus dem prallen Leben gegriffen. Eisner erzĂ€hlt von Armut und Verelendung, vom hoffnungslosen Dasein einer gesichtslosen Angestelltengesellschaft und von Menschen, die trotz vieler RĂŒckschlĂ€ge nie die Hoffnung auf ein besseres Leben verlieren. Oft genug tritt seine Hauptfigur, der maskierte VerbrecherjĂ€ger Spirit, dabei in den Hintergrund oder dient lediglich als Katalysator, der die Handlung zu ihrem bestmöglichen Ende bringt. Eisners Kunst besteht darin, dem Leser seine Gesellschaftskritik nicht mittels eines platten Naturalismus um die Ohren zu hauen. Seine Stilmittel haben immer Humor und MitgefĂŒhl umfasst. Warmherzig, eben - oder kitschig... (Lutz Göllner) Lesetipps:
 Platz 18
Platz 18
Lucky Luke
Lucky Luke von Goscinny und Morris (eigentlich: Maurice de BevĂ©re) gehört zu den Comics, ĂŒber die mittlerweile vielleicht zu selten ein lobendes Wort verloren wird, da eh jeder wenigstens ein paar BĂ€nde ganz selbstverstĂ€ndlich im Regal stehen hat. Das liegt aber mitnichten an irgendwelchen âBin-damit-aufgewachsenâ-SentimentalitĂ€ten, sondern schlicht an der QualitĂ€t. Zusammen mit Asterix ist die Westernserie um den Mann, der schneller schiesst als sein Schatten, und dessen Untersatz Jolly Jumper, ein Hegel der Pferde, eine der WiederundwiederholungslektĂŒren, die sich null abnutzen und einen von der Wiege bis ins Grab begleiten. Das hat seine GrĂŒnde: beide Reihen hat Goscinny getextet, Olympier unter den Szenaristen, dessen Einzelstellenkomik ein NacherzĂ€hlpotential wie die besten Monty Python - Sketche besitzt. ZusĂ€tzlich schafft er es, seinem Revolverhelden in den mit allerlei Wilder-Westen-Facts (Wells Fargo, Siedlertrecks, Stacheldraht, Jesse James, Calamity Jane etc.) angereicherten Bombenstories ernstnehmbare CharakterzĂŒge zu verleihen, was den einsamen Ritt in den Sonnenuntergang (die running Schlussszene) immer wieder ĂŒberzeugen lĂ€sst. Morris ist dabei ein Grossmeister des Minimalismus, dessen Barkeeper oder KopfgeldjĂ€ger schon mal aussehen wie Alfred Hitchcock oder Lee van Cleef, der aber derart karikierende Elemente sparsam am Rande einsetzt und sich mehr auf die spröde, staubig-karge Inszenierung seiner schratigen Figuren konzentriert. Ăberhaupt ist das alles keine Parodie, sondern völlig in sich funktionierend, dabei aber nicht weniger âauthentischen Westernâ rĂŒberbringend als Blueberry. Wenn man viele Comics wegwerfen mĂŒsste - diesen nicht. (Sven-Eric Wehmeyer) Lesetipps:
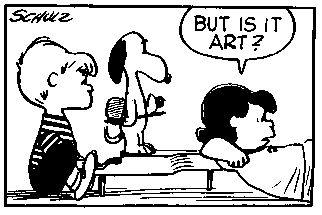 Platz 19
Platz 19
Peanuts
Die Peanuts-Sonntagsseite vom 11. Oktober 1964: Charlie Browns Schwester Sally ist ganz unbekĂŒmmert mit SeilhĂŒpfen beschĂ€ftigt, als sie plötzlich innehĂ€lt und zu weinen anfĂ€ngt. Besorgt kommt Linus herbeigelaufen und fragt: "Was ist denn los, Sally? Ist was passiert? Warum weinst du so?" Und Sally antwortet ihm: "Ich weiĂ auch nicht... ich bin seilgesprungen und fĂŒhlte mich prima... als mit einmal... alles so vergeblich schien." Hmm, ist das jetzt ein brauchbarer (oder mehr als brauchbarer) Versuch, diesem allseits bekannten GefĂŒhl, wenn einem ohne ersichtlichen Grund der Boden unter den FĂŒĂen weggezogen wird, eine Ă€sthetische Form zu verpassen, oder handelt es sich einfach nur um banalen Kitsch, der einen Komplex wie AbgrĂŒndigkeit dazu benutzt, um Credibility vorzutĂ€uschen und ansonsten ĂŒber dĂŒmmliche Niedlichkeiten und moralinsaure ScheiĂe funktioniert? Ja, richtig vermutet, ich gehe davon aus, dass ersteres der Fall ist. Denn anstatt eine Auflösung des hier dargestellten Problems zu prĂ€sentieren - es also zu entschĂ€rfen (Marke: "ist doch nicht so schlimm") - wird selbiges zunĂ€chst in seiner ganzen PhĂ€nomenalitĂ€t ausgewalzt und dann erst auf dem letzten Panel dem Leser/Linus staubtrocken und ohne einen Funken Hoffnung an die verdatterte Weichei-Birne geworfen. Die Pointe ist, dass die Pointe gar keine Pointe ist und trotzdem wie eine wirkt. Genial! Diese Sonntagsseite von 1964 steht hier stellvertretend fĂŒr all die Peanuts-Strips, die Charles M. Schulz (1922-2000) 50 Jahre lang (1950-2000) mit mehr oder minder gleichbleibender QualitĂ€t (Konsens ist - und dem schlieĂe ich mich an - dass seine Arbeiten aus den Sechzigern und frĂŒhen Siebzigern den Höhepunkt darstellen) und ohne einen einzigen Tag Unterbrechung gezeichnet hat. (Marc SagemĂŒller) Lesetipps:
Leseproben:
 Platz 20
Platz 20
Krazy Kat
Er war trotz der langen Laufzeit nie ein groĂer Erfolg. Gottseidank gehörte Medien-Tycoon William Randolph Hearst zu seinen fanatischsten Bewunderern und sorgte dafĂŒr, daĂ George Herrimans Zeitungsstrip Krazy Kat bis zu dessen Tod 1944 in seinem New York American veröffentlicht wurde. âKrazy Kat lĂ€Ăt sich mit keinem anderen Comic-Strip davor oder danach vergleichenâ, sagt Calvin & Hobbes - Schöpfer Bill Watterson ĂŒber das Werk, das in ziemlicher Einigkeit als der gröĂte amerikanische Comic ĂŒberhaupt bezeichnet wird. Pablo Picasso war ebenso Fan wie Gertrude Stein, die Sprachshaker James Joyce den Inhalt der neuesten Folgen durchs Telefon beschrieb, wenn der sie nicht lesen konnte. Das Idiom, in dem Herriman seine Figuren sprechen lĂ€Ăt, ist denn auch als aus verschiedenen Sprachen zusammenbabylonisierte Klitterung von Slangsounds, Neologismen und bis zum Wahn vergnurgsten Puns nicht furchtbar weit von Finnegans Wake entfernt. Doch Krazy Kat schlĂ€gt an keiner Stelle, wie es sich fĂŒr groĂe Kunst gehört, kultursnobistische Krampffalten. Variiert wird im Kern lediglich dieses: Krazy Kat (wahrscheinlich eher weiblich) liebt Ignatz Maus. Ignatz haĂt die Katze und ballert ihr Ziegelsteine an den SchĂ€del, um den bei jedem Treffer Herzchen schwirren. Offissa Pupp liebt Krazy und versucht, sie vor der gnatzigen Maus zu schĂŒtzen. Abspielen tut sich dieses verkorkst-sanfttraurige, mit Humor vom Mars versehene GefĂŒhlsdramolett im wĂŒstenartigen Coconino County, in welchem, wechselnd von Panel zu Panel, VorhĂ€nge auf- und zugehen, seltsame Kakteen zu seltsameren Felsen werden, es plötzlich vom Tag zur Nacht schwenkt und angeknusperte Monde an FĂ€den vom Himmel hĂ€ngen. Krazy Kat zeigt nahezu alles, was die Kunstform zu leisten vermag, bleibt dabei aber in seiner stricheligen, schwerelosen SchrĂ€gness locker, bescheiden und unfaĂbar unantiquiert - ein Strip ohne jeden Makel und derart frisch, als wĂ€re soeben die Tusche getrocknet. (Sven-Eric Wehmeyer) Lesetipps:
 Platz 21
Platz 21
Conan
â...und dannâ, so beschreibt Barry Windsor-Smith gerne das Ende seiner ersten Zeit in Amerika, âkamen zwei freundliche Herren von der Einwanderungsbehörde und zeigten mir den Weg zum Hafen.â Exit Barry Smith, talentierter, aber keineswegs auffĂ€lliger Kirby-Epigone, der als AbschluĂarbeit an der königlich-britischen Kunsthochschule eine Neuinterpretation des Kampfes Hulk gegen das Ding abgeliefert hatte und die freundliche Bewerbungsablehnung der Marvel-Redakteurin Marie Severin (âWenn Sie in der NĂ€he sind, schauen Sie doch vorbei.â) als Aufforderung zur Immigration miĂverstand. Im Winter 1969 lebte er zeitweise in New York auf einer Parkbank, ging tagsĂŒber ins Marvel-BĂŒro und zeichnete bis zu seiner Ausweisung jedes Skript, das man ihm vorlegte. Sein GlĂŒck war, daĂ Roy Thomas, damals zweiter Mann im Verlag hinter Stan Lee, dringend einen Zeichner fĂŒr sein Projekt âConan The Barbarianâ suchte und dafĂŒr auf Barry Smith verfiel. Noch von England aus zeichnete der damals 21jĂ€hrige die ersten Hefte der Serie. Gleichzeitig bemĂŒhte sich der Verlag vor den obersten Gerichtshof der USA, um dem jungen Zeichner als bescheinigtes Genie die Einwanderung zu ermöglichen. Mit der Lösung dieses politischen Problems platzte auch bei Smith der kĂŒnstlerische Knoten: Das vierte Conan-Heft The Tower Of The Elephant brach radikal mit dem Kirby-Stil. Smith, geschult an den britischen PrĂ€raffaeliten und anderen KĂŒnstlern des Jugendstils, schuf seine eigene Fantasywelt. Harte Action trat immer mehr in den Hintergrund zugunsten von Mimik, exotischen Landschaften und flĂ€chigen Ornamenten. Doch Smith kolidierte zunehmend mit dem amerikanischen Verlangen nach Seiten. âI Must be mad, sitting here drawing all these coinsâ, versteckte er als Botschaft in einem Panel seines achten Conan-Hefts. Dennoch blieb er bis zur Nummer 24 an Bord. Auch wenn zwei Hefte lediglich Reprint-Material prĂ€sentierten und zwei von Gastzeichner Gene Colan waren bleibt Conan doch Smiths beste Arbeit und einer der schönsten runs, den amerikanische Comicserien zu bieten hatten. (Lutz Göllner) Lesetipps:
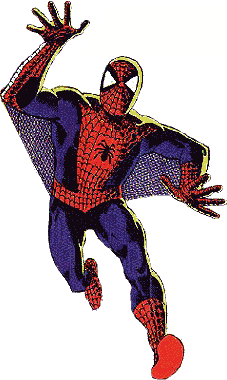 Platz 22
Platz 22
Spider-Man
Als Spider-Man 1962 in »Amazing Fantasy« 15 an seinen Spinnenweben ins Rampenlicht der Ăffentlichkeit schwang, kam dies einer kleinen Revolution gleich. Wohl niemand hĂ€tte damals den phĂ€nomenalen Erfolg dieser Figur voraussehen können, der heute, nach ĂŒber drei Jahrzehnten, nicht weniger als vier eigene Reihen gewidmet sind. »Du kannst ihn nicht Spider-Man nennen, weil die Leute Spinnen hassen.« - »Ein Teenager kann doch kein Superheld sein.« - »Du kannst ihm nicht so viele Probleme andichten - er wird nicht mehr heroisch genug erscheinen« - »Ein Held muĂ groĂ und stark sein« Stan Lee und Steve Ditko lieĂen sich von diesen EinwĂ€nden nicht beirren und schufen einen der originellsten Superhelden, dessen erstes Heft zum gröĂten Erfolg des Verlages avancierte. Im Gegensatz zu seinen adretten, immer korrekt gekleideten und gut gelaunten Superhelden-Kollegen war Spider-Man ein Mensch mit Ecken und Kanten der mit seinen eigenen UnzulĂ€nglichkeiten genauso zu kĂ€mpfen hatte, wie mit seinen Feinden; der nicht nur regelmĂ€Ăig sein KostĂŒm, sondern auch sein Liebesleben zu flicken hatte; der zwar jede Menge Sorgen hatte, aber immer auch einen flotten Spruch auf den Lippen fĂŒhrte, mag die Situation auch noch sie aussichtslos sein. Die Ursprungsgeschichte verlĂ€uft noch nach Schema F: Der Highschool-SchĂŒler Peter Parker wird von einer radioaktiven Spinne gebissen und erhĂ€lt dadurch deren proportionale Kraft und Wendigkeit. Mit seinen hervorragenden Chemiekenntnissen entwickelt er synthetische Spinnweben, die er aus kleinen DĂŒsen an den Handgelenken hervorschieĂen und daran durch Manhattans HĂ€userschluchten schwingen kann. Der Mord an seinem Onkel Ben, den er hĂ€tte verhindern können, fĂŒhrt ihn zu der Erkenntnis, daà »mit groĂer Macht auch groĂe Verantwortung einhergeht«, und so widmet er sein weiteres Leben der VerbrechensbekĂ€mpfung. Im Gegensatz zu andern Superhelden wird er jedoch nicht bewundert, sondern von der Polizei gejagt und von seinen MitbĂŒrgern gefĂŒrchtet. Wie keine zweite Figur verkörpert Spider-Man den Marvel-Kosmos, und auch wenn seine Anfangsjahre gegen die heutige Inflation von grafischer Gewalt und inhaltlicher Leere recht antiquiert wirken, sind sie doch immer noch herrlich unterhaltsam. (Cord Wiljes) Lesetipps:
 Platz 23
Platz 23
Johann & Pfiffikus
NatĂŒrlich ist er der Meister der SchlĂŒmpfe. Mit seinem rundlichen, geschmeidigen Stil konnte wohl Pierre Culliford alias Peyo (1928-1992) gar nicht anders, als frĂŒher oder spĂ€ter den Niedlichkeitsnerv eines Massenpublikums mitten ins Mark zu treffen. Nichts ist jedoch absturzgefĂ€hrdeter als ein âOh, wie sĂŒĂ!â-Faktor, vor allem, wenn man ihn noch mit Merchandise-MĂŒll und mediokren Zeichentrickfilmchen traktiert. Das konnte einem das zweifellos berechtigte VergnĂŒgen an den frĂŒhen Schlumpf-Geschichten grĂŒndlich vermiesen, und dazu hĂ€tte es Vader Abraham noch nicht mal gebraucht. Eine Misere, die Peyo sogar nach KrĂ€ften gefördert hat. Und wĂ€hrend die blauen Zwerge ĂŒber die Bildschirme tollten, durch komische Kakao-Werbung zogen und natĂŒrlich als PVC-PĂŒppchen in albernsten Verkleidungen aus unzĂ€hligen SetzkĂ€sten purzelten, hatten ihre eigentlichen Entdecker darunter am meisten zu leiden. 1958 betraten Johann und Pfiffikus erstmals das âVerwunschene Landâ, Heimat der SchlĂŒmpfe. Zu diesem Zeitpunkt waren sie bereits fest etabliert. Johann verkörperte als Page eines sympathischen Königs in einem kleinen Mittelalter-Reich die klassischen Rittertugenden, stets edel, hilfreich und gut. Dasselbe lieĂe sich auch von seinem treuen Begleiter und Knappen Pfiffikus sagen - klein, aber oho -, wĂ€re er weniger temperamentvoll, verfressen, aufschneiderisch, musikliebend (obwohl völlig unmusikalisch) und in ruhigeren Zeiten eine einzige Landplage - kurz: wĂ€re er nicht Pfiffikus. Dieses ungleiche Gespann hatte bis dahin trotzdem gemeinsam, umsichtig und tollkĂŒhn in fĂŒnf Jahren und sechs Alben zahlreiche Schurken schachmatt gesetzt, manchen Spuk beendet sowie Witwen und Waisen beschĂŒtzt. Damit zĂ€hlten sie ohne Zweifel zu den Stars des âSpirouâ-Magazins. Und dann begegneten ihnen zufĂ€llig die SchlĂŒmpfe... Auch mit den blauen Wichteln lieĂ der Reiz ihrer Abenteuer keineswegs nach. Nur wurden sie sie erst nicht mehr los, dann ihre Auftritte zunehmend seltener, und schlieĂlich verschwanden sie sogar ganz, weil Peyo vor lauter SchlĂŒmpfen schlicht keine Zeit mehr fĂŒr sie fand. Wie er seine Comic-AktivitĂ€ten letztlich ĂŒberhaupt nahezu einstellte, da er sich fast nur noch um die Zweit-, Dritt- und Viertverwurstung seines Mega-Erfolgs mit den Miniwesen kĂŒmmerte. So lag jahrelang ein Szenario fĂŒr eine weitere âJohann und Pfiffikusâ-Episode in Peyos Schublade, aber erst nach seinem plötzlichen Tod wurde es unter FederfĂŒhrung seines Sohnes Thierry von Zeichnern aus dem schon lange vorher gegrĂŒndeten Studio Peyo realisiert. (Und noch zwei weitere folgten seitdem, neben einigen Schlumpf-BĂ€nden!) Peyos RĂŒckzug aus dem Comic-GeschĂ€ft war insofern schade, als seine ĂŒberaus klare, eingĂ€ngige Graphik und sein GespĂŒr fĂŒr unterhaltsames GeschichtenerzĂ€hlen ihn binnen weniger Jahre zu einem Meister und vielleicht den typischsten Vertreter der âEcole Marcinelleâ gemacht hatten, jener Stilmischung der âSpirouâ-Equipe, die sich bei aller individuellen Verschiedenheit in ihrer Dynamik deutlich - und zwar wohltuend - absetzte vom damals fĂŒr vorbildlich gehaltenen, aufgerĂ€umten und âsauberenâ Strich Ă la HergĂ©. Dabei hatte man Peyo als absoluten Autodidakten erst Jahre spĂ€ter zu âSpirouâ geholt, nachdem seine einstigen Arbeitskollegen Franquin, Morris und Eddy Paape dort bereits 1946 das Heft in die Hand genommen hatten. In dieser Zeit suchte Peyo noch seinen Stil, konnte aber auch schon 1946 in einer belgischen Zeitung erste, sporadische Gag-Strips um einen Pagen namens Johann veröffentlichen. Der sah allerdings noch aus wie eine unbeholfene Kopie von Tim, mit blonden Schillerlocken! Nachdem sich sein Strich soweit gefestigt hatte, daĂ von 1952 an Johanns Abenteuer in âSpirouâ erschienen, so betrachtete Peyo selbst rĂŒckblickend auch die beiden ersten Episoden dort noch als AbschluĂ seiner langen Anlaufphase, in der er ihn zudem Kollege Franquin gelegentlich mit Tips unterstĂŒtzte. Der Durchbruch kam 1954, als Pfiffikus auftauchte - und einfach blieb, obwohl nicht unbedingt vorgesehen. Nun hatte Peyo seine Idealbesetzung gefunden, und seine im Grunde recht einfachen, geradlinigen Plots bekamen durch Pfiffikusâ Auftreten, dessen ĂŒberschĂ€umendes, bisweilen kaum zu bĂ€ndigendes Temperament jene Energie und die notwendigen Aus- und Abschweifungen, durch die die Serie bis heute so lebendig erscheint. Dazu noch der Aufschwung der Graphik in den folgenden Jahren bis auf meisterliche Höhen - im Grunde ruht der nachmalige Erfolg der SchlĂŒmpfe auf den Schultern dieser Comic-Riesen. Ein waghalsiges, letztlich aber ein versöhnliches Bild. Mochten sie danach auch hinter ihre Zufallsbekanntschaft zurĂŒcktreten, es war ein RĂŒckzug in WĂŒrde. Die Abenteuer von Johann und Pfiffikus sind heute Klassiker, ihr Auftritt hat fraglos Comic-Geschichte geschrieben. (Martin Budde) Lesetipps:
 Platz 24
Platz 24
Cages
Ende der achtziger Jahre war der Brite Dave McKean einer der angesagtesten Zeichner der Stunde. Sein Debut âViolent Casesâ hatte ihn (und seinen kĂŒnftigen Leibszenaristen Neil Gaiman) direkt in die Ehrenloge der Comicszene katapultiert â sein gekonnter Fotorealismus und seine extrem hippen Collagetechniken lieĂen Kritiker und Leser reihenweise aus den Schuhen kippen. Doch wĂ€hrend die Welt nach mehr schrie, war der Meister selbst bereits von seinem eigenen Oevre gelangweilt. FĂŒr McKean war das alles nichts als bloĂes Handwerk, das ĂŒberdies den meisten Stories eher schadete als nĂŒtzte; natĂŒrlich war das Artwork von BĂ€nden wie âDer Tag der Narrenâ augendurchbohrend, lenkte aber letztlich mehr von der Geschichte ab, als sie zu erzĂ€hlen. McKean beschloĂ, zunĂ€chst nur Cover zu machen und nebenbei an seinem ersten komplett selbstverfaĂten Comic zu arbeiten â in einem neuen Stil, der seiner Geschichte dienlich sein sollte, statt sie zu ĂŒberstrahlen. Mit âCagesâ hatte er sich reichlich viel vorgenommen. Schon der pathetische, mythische Prolog im ersten Heft deutete an, daĂ es hier um nichts weniger gehen sollte als um das Leben, das Universum und den Rest; die definitive Meditation ĂŒber âSchöpfungâ stand zu erwarten, und zwar in allen nur denkbaren Bedeutungen des Wortes. Eine auf zehn Teile angelegte Serie, die McKeans WeltverstĂ€ndnis von Kunst, Musik und Literatur auf den Punkt bringen sollte. Ein heeres Unterfangen: acht Jahre und zwei Verlagswechsel sollte es dauern, bis die Reihe ihren AbschluĂ fand. Was allerdings da auf 500 Seiten auf den Leser zurollt, ist schlichtweg einer der schönsten, schillerndsten und faszinierensten Arbeiten, die sich je in die Annalen der Comicgeschichte eingegraben haben. ErzĂ€hlt wird die Geschichte des Malers Leo Sabarsky, der auf der Suche nach Inspiration und einem neuen Lebensanfang in ein verwunschen anmutendes Londoner Viertel zieht. Ehe er sich versieht, steckt er bereits mitten in einem Universum voller erstaunlicher Persönlichkeiten, in der sich Situationen von typisch britischer SchrĂ€gheit abwechseln mit hinreiĂenden Dialogen ĂŒber Gott, Jazz, Sex und Katzen. Die grazilen Federzeichnungen, die als einzige Nuance zwischen schwarz und weiĂ nur einen kĂŒhlen Blaugrau-Ton zulassen, werden wohldosiert von fiebrigen, Traumsequenz-artigen Interludes durchbrochen, in denen McKean ein Feuerwerk seiner Collagekunst auf den Leser loslĂ€Ăt. Aus jedem Panel in âCagesâ strahlt einem eine Schaffens- und Experimentierfreude entgegen, die nur von Leuten erreicht wird, die auf groĂe Entdeckungsreise in ihren Parametern gehen. Genau fĂŒr so was hat man einst die Worte âArtworkâ und âgrafisches ErzĂ€hlenâ erfunden. (Thomas StrauĂ) Lesetipps:
 Platz 25
Platz 25
Calvin & Hobbes
Ein Kind, das permanent seine Umgebung terrorisiert, weil es partout nur das tun möchte, was ihm gefĂ€llt? Das ist nicht komisch, auĂer im Comic. Calvin ist so ein Comic-Kind, wie es sie seit den AnfĂ€ngen des Mediums immer gegeben hat: Vom âYellow Kidâ und seinen Kumpanen bis zum âkleinen Spirouâ durften sich diese Gören auf dem Papier danebenbenehmen, daĂ die Fetzen nur so flogen. Und es hat amĂŒsiert. Wohl weil diesen Comic-Kindern das abgeht - bzw. weil sie dagegen rebellieren -, was ihr erwachseneres Publikum zu genĂŒge genossen hat: Erziehung. Der Kontrast zwischen Ungezogenheit und comme il faut ist fundamental - bei Freud etwa heiĂt er Natur und Kultur - und immer fĂŒr einen Lacher gut, denn jeder reibt sich auf irgendeine Weise daran. Calvin ist deshalb kein echter, sechsjĂ€hriger ErstklĂ€Ăler. Er und all die anderen Comic-Kids seiner Art sind junge Wilde, dazu da, diesen ominösen Gegensatz stellvertretend fĂŒr ihre bravere Leserschaft offen auszutragen und ihn so zu entschĂ€rfen. Die Calvin-Methode hat allerdings Charme: Seine unerschöpfliche Phantasie und sein impulshafter Charakter ermöglichen es ihm, sich fast jeder pĂ€dagogischen Zumutung spielerisch zu entziehen. Und sie verschaffen ihm den dringend erforderlichen RĂŒckhalt in der tagtĂ€glichen Auseinandersetzung mit einer ganzen Zivilisation: seinen PlĂŒschtiger Hobbes. Mag er auch fĂŒr alle anderen ein Stofftier sein und bleiben, fĂŒr Calvin ist er wirklicher als die Wirklichkeit - mit ihm kann er alle Interessen wie auch Gedanken und Ansichten teilen. Hobbes macht alles mit, wird ihm nie widersprechen (auch wenn er bisweilen seine eigenen Auffasungen hat, besonders Tiger betreffend) und weiĂ darĂŒber hinaus gelegentlich mit freundschaftlichem Rat Calvin aus so mancher Klemme zu helfen. Man könnte sogar sagen, Hobbes ist hĂ€ufig die etwas klĂŒgere HĂ€lfte des fĂŒr gewöhnlich unzertrennlichen Gespanns. Daneben beschreitet Calvin aber auch öfter Solopfade und schlĂŒpft in Alter Egos, die er meist gĂ€ngigen Trivialmythen entlehnt - ob als Spaceman Spiff, Privatdetektiv Trigger Bullet, als Superheld âStupendous Manâ alias âder UnfaĂbareâ, oder wenn er einfach als Tyrannosaurus Rex durch die Gegend stapft, stets geht er ganz und gar in seiner Vorstellungswelt auf. Zumindest solange, bis ihn die Wirklichkeit einholt und ihn aufgebrachte Eltern, verĂ€rgerte Lehrer oder eine wĂŒtende Babysitterin zur Rede stellen. Allerdings zeigt sich nicht erst im Repertoire seiner Phantasiewelten, daĂ Calvin im Zweifel ĂŒber mĂ€chtige Komplizen verfĂŒgt, die helfen, das Konzept einer Erziehung bestĂ€ndig zu unterlaufen: die modernen Massenmedien, allen voran natĂŒrlich das Fernsehen (Comics im ĂŒbrigen auch). Calvin ist ein begeisterter und vor allem bekennender Vielseher, denn mit den bequemen und billigen Ersatzwirklichkeiten kommt gleichzeitig auch die Medienkritik frei Haus. Calvin weiĂ also, was er da tut, wenn er apathisch vor dem Fernseher versinkt - und genieĂt es trotzdem. In dieser Hinsicht ist er ein âaufgeklĂ€rter Wilderâ. Und ein getreues Spiegelbild der durch und durch vernunftorientierten Informationsgesellschaft, die einerseits auf den RationalitĂ€tsdruck mit wachsender Faszination am Irrationalen reagiert und ansonsten unbequeme Konsequenzen konsequent ignoriert. Was andernorts zumal in Zeiten schwindender Verbindlichkeiten bedenklich sein mag - in âCalvin & Hobbesâ wird es allemal dadurch gebannt, daĂ MĂ€chte existieren, die Calvins Unvernunft zĂŒgeln: die Gesamtheit der offiziellen Erziehungsbeauftragten eben. âCalvin & Hobbesâ ist aber noch mehr als ein witziger, einfallsreicher Kommentar zum âUnbehagen an der Kulturâ (wiederum Freud). In der Kindperspektive erschlieĂt sich zwischen all den Allmachtsphantasien Calvins, seinen Ăngsten, ĂŒberzogenen AnsprĂŒchen und alltĂ€glichen Niederlagen noch einmal der SpaĂ am Abenteuer Heranwachsen, das spielerische FreirĂ€ume ausschöpft und kreative Fragen und Antworten umfaĂt. Es scheint, als habe ein Teil davon auch auf Bill Watterson selbst, Calvins Urheber, abgefĂ€rbt, der in seinem Strip immer wieder nach originellen, ungewöhnlichen Ansichten gesucht und zĂ€h darum gekĂ€mpft hat, sie verwirklichen zu können. Von Anfang an - Ende 1985 - wuĂte er, daĂ die Funktionsweise des Comics ihm die optimale Möglichkeit bot, die Perspektivwechsel zwischen Calvin und seiner Umgebung zu visualisieren; und diese Methode des Hin- und Herschaltens hat er ĂŒber Jahre weiter verfeinert - mit zum Teil ĂŒberraschenden graphischen Ergebnissen. Trotzdem scheint es unausweichlich, daĂ jedem Spiel irgendwann die Erstarrung zur Routine droht. Auch wenn es lĂ€nger dauert und zahlreiche Varianten es zusĂ€tzlich hinauszögern: Eines Tages hat man die Regeln kapiert. Man könnte zwar noch eine ganze Weile weitermachen wie gehabt, aber es wĂ€re nicht mehr dasselbe. Watterson hat schlieĂlich gespĂŒrt, daĂ ihm genau diese Sackgasse einmal bevorstĂŒnde. So hat er von sich aus den SchluĂstrich gezogen und - ungewöhnlich genug - seinen ĂŒberaus erfolgreichen Comic strip Anfang 1996 eingestellt. Nicht umsonst lautet ja die einzige Regel bei Calvinball, daĂ man es nie zweimal nach den gleichen Regeln spielen darf. Tut man es trotzdem, beginnt das Lernen. Und wie sagte Hobbes einmal dazu? âLeben und nicht lernen, das sind wir!â Gut gebrĂŒllt, Tiger. Dabei mag es denn bleiben. (Martin Budde) Lesetipps:
Platz 26 Alles
Angeblich soll Alex Toth (ĂŒbrigens hat mir bis heute keiner sagen können, wie man das vernĂŒnftig ausspricht. Folgende unbefriedigende Angebote gibt es: "Tott", "Tohss" und "Tuhss" (fehl eigentlich nur noch "Tut", "Tröt" und "Tööhröööh"). Wer kann weiterhelfen? Auf Zuruf!) ja eine total reaktionĂ€re Arschgeige sein. Von mir aus. Als bester Comiczeichner der Welt soll er sein Recht auf Meinungsfreiheit ruhig voll auskosten... Momentchen mal, hör ich die Leude jetzt intervenieren, bester Comiczeichner der Welt? Ditt soll wohl ân Witz sein? Nee, denn in diesem Fall ist ausschlieĂlich das gemeint, was man unter dem hochgradig problematischen Begriff Zeichenkunst versteht. Der irgendwann in den Zwanzigern geborene BarttrĂ€ger schafft es nĂ€mlich wie kein/e zweite/r, das VerhĂ€ltnis zwischen den alles bestimmenden Parametern Zeigen, Andeuten und Weglassen so, ich möchte fast sagen: essentiell, auszuloten. Jedes seiner Panels stellt erneut die Frage nach der Substanz, der dort dargestellten Situation und spĂŒlt gnadenlos all die ĂŒberflĂŒssigen Informationen ab durchs Klo nach Mittelerde, wo sie hingehören. Der Clou dabei ist - und jetzt aufgemerkt! -, dass sich seine Arbeiten (hier ein paar Geschichtchen fĂŒr DC und Warren, da einige Zorro-Hefte fĂŒr Dell, hier drei kleine Gastauftritte bei EC etc) durch eine inhaltliche und thematische Belanglosigkeit auszeichnen, die sich gewaschen hat. Toth geht es allein um Form, Form und nochmals Form, was ihn nicht nur zum besten, sondern auch zum abstraktesten aller Comiczeichner macht. Holt euch seine ausgerechnet bei Image erschienene Zorro-Gesamtausgabe, lest diesen superheiĂen GourmetscheiĂ, fallt in Ohnmacht und verratet mir endlich, wie dieser Vogel ausgesprochen wird. (Marc SagemĂŒller) Lesetipps:
 Platz 27
Platz 27
Modesty Blaise
Modesty Blaise war der erste Multimediagriff der Unterhaltungskultur (als Comic, Buch und Film mit der bedrĂŒckenden Monica Vitti und schlieĂlich sogar im Fernsehen). Der erste Modesty-Strip erschien 1963 im Londoner Evening Standard. Als Zeichner hatte sich der Autor Peter OâDonnell den Zeitungsveteranen Jim Holdaway ausgeguckt. Eine gute Wahl, denn Holdaway blieb dem Strip bis zu seinem frĂŒhen Tod im Jahr 1970 treu. Erst 1965 debĂŒtierte Modesty Blaise als Romanfigur, doch trat hier ein merkwĂŒrdiger Effekt ein: Die vollkommen durchgeknallten Plots von OâDonnells Romanen, die sich oft nicht um Wahrscheinlichkeit und innere Logik scherten, lasen sich weit comichafter als der Comic-Strip selbst, da sie nur Abfallprodukt der Comics um die tödliche Lady waren. Modesty war ein typisches Produkt der swinging sixties und ist so britisch wie die Beatles. Sie ist eine ehemalige Diebin, die eine mafiaĂ€hnliche Bande hochgezogen hat, stinkreich geworden ist und sich inzwischen ehrlich gemacht hat. Von Zeit zu Zeit nimmt der britische Geheimdienst ihre Dienste und die ihrer Organisation in Anspruch, meist jedoch lebt sie in den Tag hinein und verbringt ihre Tage auf der Jagd nach AntiquitĂ€ten und Sex (ja, sie hat schon in den Sechzigern selbstbestimmten Sex, damals eine Revolution). Ihr zur Seite steht ihr treuer Freund Willie Garvin, ein Nahkampfexperte, der sich ironischerweise vor Feuerwaffen fĂŒrchtet. Die Plots, die sich OâDonnell fĂŒr die Romane und die Zeitungstrips ausdenkt, bewegen sich oft an der DebilitĂ€tsgrenze, sind jedoch immer unterhaltsam und spannend, Pulpliteratur im besten Sinne des Wortes. Im Gegensatz zu vielen anderen tĂ€glich erscheinenden Zeitungsstrips verzichteten OâDonnell und Holdaway auf die ĂŒblichen Rekapitulationen des bisher Geschehenen. Dadurch entsteht ein flĂŒssiger Handlungsablauf. Der Grund dafĂŒr: Die Abenteuer der tödlichen Lady wurden von vornherein seitenweise konzipiert und nicht, wie sonst ĂŒblich, von Tag zu Tag. Dadurch entsteht ein gleichbleibender Lesefluss. OâDonnell schrieb immer erst ein Drehbuch, bevor er sich mit den Zeichnern besprach. Jim Holdaway war ein Meister seines Faches, der sich ganz genau ĂŒberlegte, welche Perspektive fĂŒr die jeweilige Szene notwendig war. Er arbeitete sehr filmisch mit Schnitt/Gegenschnitt, durch groĂe schwarze und weiĂe FlĂ€chen schuf er Kontraste und durch gezielte Schraffierungen erreichte er Grautöne, die den Strips erst ihre AtmosphĂ€re gaben (wer sagt eigentlich, das Comics immer bunt sein mĂŒssen?). Holdaway verstand es auch, den Comics einen sehr verhaltenen britischen Sex zu geben. Eine nackte Schulter oder ein entblöĂtes Bein von Holdaway hatte mehr Sex als die Monstertitten-Modesty seines Nachfolgers Enrique Badia-Romero. Dieser konnte erwartungsgemÀà den hohen Standard der Serie nicht halten. Dazu kamen Schwierigkeiten im VerstĂ€ndnis, denn Romero sprach nur sehr schlecht Englisch. 1978 gab Romero die Serie dann zunĂ€chst an John Burns ab, der jedoch bereits nach 12 Monaten das Handtuch warf. Es folgte ein zehnmonatiges Gastspiel von Patrick Wright, bevor Modesty fĂŒr die nĂ€chsten sieben Jahre Ă€uĂerst kompetent von Neville Colvin gezeichnet wurde. Inzwischen war auch Romero wieder auf den Geschmack gekommen (und hatte vermutlich auch besser Englisch gelernt): Seit 1986 ist er wieder OâDonnells Kollaborateur. ErwĂ€hnenswert auch, das Miramax Mitte der neunziger Jahre an einem neuen Filmscript arbeitete und DC in dieser Zeit eine von Dick Giordino wunderbar altmodisch gezeichnete Version des ersten Romans veröffentlichte. Leider sind inzwischen alle OâDonnell-Veröffentlichungen auf deutsch vergriffen. Das gilt fĂŒr die elf BĂŒcher, die zwischen 1965 und 1985 entstanden sind und bei Rowohlt veröffentlicht wurden, genauso wie fĂŒr die neun ComicbĂ€nde, die das gesamte Schaffen von Holdaway sammelten und bei Carlsen erschienen sind. Heute ist OâDonnell 80 Jahre alt und schreibt nur noch den tĂ€glichen Strip. Allerdings hat er Modestys Abschied wunderbar vorbereitet: In dem 1996 erschienenen Roman "Cobra Trip" sind Modesty und ihr Freund Willie alt geworden und werden ein letztes Mal vom Geheimdienst reaktiviert. (Lutz Göllner) Lesetipps:
 Platz 28
Platz 28
Wash Tubbs & Captain Easy
Da haben wir es wieder: Alan Moore ist eben nicht nur Genie und Superkiffer sondern auch noch Fuchs und Kenner. Als er 1996 den Image-Superman Supreme in "The Land Of A Thousand Supremes" (Supreme Vol. 2 #41) auf etliche Parallel-Supremes treffen lĂ€sst, wird ihm von seiner MajestĂ€t Supreme dem FĂŒnften auch Original-Supreme vorgestellt. Der erzĂ€hlt ihm dann, dass er Anfang der zwanziger Jahre als Sohn des Ehepaares Crane zur Welt kam und eigentlich nur ein kleiner Knirps mit Brille und Haartolle war, bis er in einer Höhle die silberne GĂŒrtelschnalle fand, mit deren Hilfe er sich von da an in einen Superhelden verwandeln konnte. Wer weiss wie Roy Cranes Zeitungsstripfigur Washington Tubbs aussieht, dĂŒrfte die Botschaft gecheckt haben: Neben Beck, Kirby, Simon, Siegel, Shuster und Kane, welche die allseits bekannten Superhelden Captain Marvel, Batman und Superman erfunden haben, war auch noch ein gewisser Roy Crane mit seiner Serie "Wash Tubbs & Captain Easy" (1924-43) bei der Fundamentlegung fĂŒr dieses krumme aber im Prinzip irgendwie doch echt legendĂ€re Genre mit von der Partie. Was man neben dieser zugegeben reichlich historischen Info vielleicht auch noch erwĂ€hnen sollte ist, dass Cranes Duo-Tone-Technik, die er ab den frĂŒhen dreiĂiger Jahren bei den schwarzweiĂen Tagesstrips einzusetzen beginnt, seinesgleichen sucht und nicht findet, dass seine Sonntagsseiten, die ab 1933 unter dem Namen "Captain Easy, Soldier Of Fortune" laufen, in ihrer komplexen Einfachheit Ă€hnlich eyepopping daherkommen und dass das Ganze auch heute noch avec höchster PlĂ€sier gelesen werden kann. Mit anderen Worten, ein Meisterwerk von Buddahs Gnaden. (Marc SagemĂŒller)
 Platz 29
Platz 29
Theodor Pussel
Man denke sich eine Mischung aus Tim und Struppi und Corto Maltese, gewĂŒrzt mit etwas Baudelaire und Joseph Conrad. Pussel ist beinahe so rundköpfig wie der Reporter Tim, und wie der lĂ€sst er sich auf jedes Abenteuer ein. Es folgt ihm aber nicht ein kleiner weiĂer Hund, sondern der zwielichtige, schwarz gewandete Herr November, der sich eines Abends Baudelaire zitierend als Theos Schicksal vorstellt: âO bitter Wissen, eingeheimst auf Reisen...â Herrn Novembers dĂŒstere Prophezeiungen gehen in ErfĂŒllung. Theodor macht sich auf den Weg nach China, und auf der Suche nach einem verschollenen Onkel, dem KapitĂ€n Stien (nicht Haddock!), gerĂ€t er in die Irrungen und Wirrungen der Weltgeschichte. Auf seltsamen Wegen kommt er sogar zu einem Schiff und wird selbst KapitĂ€n. Zeitlich gesehen ist Pussel nur wenig spĂ€ter unterwegs als Corto Maltese; Theos Terrain ist jedoch nicht Europa oder SĂŒdamerika, sondern das koloniale Vielvölkergewimmel Ostasiens in den zwanziger und dreiĂiger Jahren. Wie Corto wird Theo geradezu magisch angezogen von SchĂ€tzen und Geheimnissen, denen er von einem Land ins andere nachjagt, um auf Piraten, Radschas, OpiumsĂŒchtige, Assassinen und schöne Frauen zu treffen - und am Ende (wie Corto) meist mit leeren HĂ€nden dazustehen. Und Herr November, der so gern Schicksal spielt, verfolgt ganz undurchsichtige PlĂ€ne. Sechs BĂ€nde fĂŒllt diese erste Reise Theodors, die die bisher erschienenen anderen vier enthalten Kindheitserinnerungen, Theos Abenteuer in Malaysia sowie eine Traumepisode, die zeitlich zu den ersten sechs BĂ€nden gehört. Die erste Idee fĂŒr seinen Helden fand Le Gall im Tagebuch eines Seemanns namens Theodore C. Le Coq, dem er die ersten Seiten fĂŒr seinen Comic entnahm, die weiteren Abenteuer Pussels sind jedoch erfunden. Le Gall erzĂ€hlt farbig und temporeich, streckenweise verwendet er eine ErzĂ€hltechnik wie Joseph Conrad in âLord Jimâ: Immer wieder setzt er bei Nebenfiguren an und arbeitet sich langsam zum Kern der Geschichte vor. OberflĂ€chlich betrachtet handelt es sich um ein gut lesbares See- und Abenteuergarn, doch auf den zweiten Blick enthĂŒllt Theos Geschichte das Doppelgesicht der menschlichen Natur. âTheodor Pusselâ wurde 1992 mit dem Max-und-Moritz-Preis der Stadt Erlangen ausgezeichnet. (Gerlinde Althoff) Lesetipps:
 Platz 30
Platz 30
Monsieur Jean
MĂ€nner, die 30 werden und bis dahin noch keiner Frau erfolgreich den Hof gemacht haben, mĂŒssen in manchen Gegenden dafĂŒr den Rathausplatz o.Ă€. fegen (solange ĂŒbrigens, bis eine âJungfrauâ sie freikĂŒĂt). Monsieur Jean, den anscheinend alle Welt nur beim Vornamen nennt, hat dieses Problem in der GroĂstadt Paris nicht zu gewĂ€rtigen. Trotzdem - oder gerade deshalb - schlĂ€gt ihm sein 30. Geburtstag schwer aufs GemĂŒt. Er ist jemand, der nur sehr zögerlich Ă€lter, erwachsen werden will und viel Zeit mit Erinnerungen und Reflexionen verbringt, vor allem, wenn es um verflossene Liebschaften geht (und davon gibt es im Leben Monsieur Jeans immerhin einige...). Die zauberhafte Leichtigkeit und die bittersĂŒĂe Schwere einer jeden Beziehung, vom GlĂŒcksversprechen zu Anfang bis zu den traurigen Momenten der Trennung, faszinieren ihn gleichermaĂen - von den alltĂ€glichen MĂŒhen dazwischen hĂ€lt er allerdings vermutlich nicht viel. Er ist eben ein Romantiker, ein Schwerenöter und Herzensbrecher in einem. Selten genug hat es Comics gegeben, in denen alles - von der Haltung der Hauptfiguren ĂŒber die Struktur der ErzĂ€hlung bis hin zu ihrer Ă€uĂeren Form - so sehr einem gemeinsamen Grundton verpflichtet ist wie in âMonsieur Jeanâ: So spielerisch wie das Verhalten des Helden mit seinem nur zögernden sich Ein- wie Loslassen kommen auch die einzelnen Geschichten daher, die sich anekdotisch, scheinbar absichtslos als lockerer Reigen aus (Tag-) TrĂ€umen, Alltagsmomenten und Reminiszenzen trotzdem im Laufe der Jahre zu einer Vita summieren. Verharrt Monsieur Jean dabei zumeist passiv und quasi zeitlos, so sorgen Ă€uĂere UmstĂ€nde fĂŒr die korrekte Chronologie - sein Freundeskreis erlebt berufliche wie private Erfolge und MiĂerfolge, er selbst bekommt AuftrĂ€ge und Auftritte (und drĂŒckt sich gerne drumrum). Kurz: man kann Monsieur Jean doch beim Ălterwerden zuschauen. Das geht zwar verlangsamt vonstatten, tut aber gar nicht so weh, wie er immer befĂŒrchtet. Im Gegenteil: selbst seine Krise zum 30. Geburtstag löst sich in Wohlgefallen auf, zuletzt ist es - wie so oft - höchst amĂŒsant (mag auch mancher Scherz schon auf Kosten Jeans gehen...). Und immer mit Stil, denn seine Urheber Charles BerbĂ©rian (*1959) und Philippe Dupuy (*1960) - sie schreiben und zeichnen die Abenteuer ihres Monsieur Jean gemeinsam (!) - folgen der Nouvelle Ligne Claire, wie ihr Pariser Freundeskreis sie in den 80er Jahren entwickelte. WĂ€hrend die meisten von ihnen, darunter Serge Clerc und Ted BenoĂźt, sich allerdings seither aus dem Comic-GeschĂ€ft weitgehend zurĂŒckgezogen haben und Yves Chaland als ihr populĂ€rster Vertreter schon 1990 verstarb, hat sich Monsieur Jean erst in den 90ern richtig entfaltet. Nicht zuletzt, weil die âNeue klare Linieâ hier perfekt zu ihrem Sujet paĂt, so retro und urban, wie sie ist, und gleichzeitig aufgeschlossen, gar utopisch genug, um nicht in Nostalgie zu versinken. AuĂerdem lassen sich Dupuy und BerbĂ©rian genug Zeit, um in ihrer sicher aufwendigeren Form der Kooperation Inhalt und Form perfekt in Einklang zu bringen. Sie sind nicht darauf angewiesen, zĂŒgig zu arbeiten, denn auĂer mit ihren Comics sind sie auch als Illustratoren erfolgreich. Insofern Ă€hneln sie selbst Monsieur Jean, der sich von selbst nie so recht festlegt, was dann gegebenenfalls andere fĂŒr ihn tun. Lieber hĂ€ngt er weiter seiner Vergangenheit nach, trĂ€umt in die Zukunft und hofft vor allem auf die Jungfrau, die ihn dermaleinst freikĂŒĂt â wohl ahnend, daĂ er sie lĂ€ngst schon getroffen haben mag... (Martin Budde) Lesetipps:
 Platz 31
Platz 31
Domu - Das Selbstmordparadies
Moment mal, werden sich jetzt einige fragen, warum kommt denn gerade âDomuâ in diese Liste und nicht âAkiraâ? Ganz einfach: weil âDomuâ um LĂ€ngen besser ist. Die meisten KĂŒnstler sollte man am besten genieĂen, wenn sie gerade âihr Dingâ gefunden haben, wenn die frische Energie nach auĂen dringt und voller ErzĂ€hlfeuer ist - bevor der ErzĂ€hler selbst merkt, was er da eigentlich tut. âAkiraâ war ein Overkill, zugegeben. âDomuâ, biographisch gesehen das GesellenstĂŒck auf dem Weg zu jenem weltweit gefeierten Mindblaster, ist eine Geschichte, in der die spĂ€ter mit stilistischem Ăberdruck auf den Leser einprasselnden Effekte noch vorsichtig dosiert und experimentierfreudig daherkommen, akzentuiert eingesetzt werden und deshalb genau das gewaltige Staunen hinterlassen, das ihnen zusteht, und nicht in einer Kaskade von lĂ€hmend schnellen Schnitten auf der Strecke bleiben. âDomuâ begann als Serie 1980 in einem Mangazine und wurde innerhalb kĂŒrzester Zeit zum Liebling der japanischen Studentenszene. Als die Serie nach 2 Jahren zu ihrem Ende kam, hatte sie bereits einen solchen Kultstatus, daĂ ihr 1983 der japanische Science Fiction Grand Prix Award verliehen wurde, ein dem âHugoâ Ă€hnlicher Preis, der bisher nur Romanen zugedacht war. Die Idee der Handlung ist so simpel wie kernig: In einer typischen tokioter Vorstadt-Beton-Burg beginnt eine Kette von rĂ€tselhaften, scheinbaren Selbstmorden. Die Polizei lĂ€uft mit ihren Ermittlungen komplett im Kreis; zu mysteriös die UmstĂ€nde, um auch nur den Hauch einer Spur zu finden. Nur das kleine MĂ€dchen Etsuko, das gerade mit seiner Familie in die Nachbarschaft gezogen ist und das ĂŒber gewaltige psychokinetische Gaben verfĂŒgt (ein von Steven Kings âFeuerkindâ geliehenes Motiv, daĂ Otomo spĂ€ter auch bei âAkiraâ als tragendes Element einsetzte), kommt dem Geheimnis auf die Schliche: der senile Greis Uchida steckt hinter den TodesfĂ€llen, auch er besitzt jenes Ausnahmetalent, mit bloĂen Gedanken Materie zum zerbersten bringen zu können, und in debiler Verspieltheit bringt der die Einwohner des Hochhauses um, weil er SpaĂ daran findet, kleine TrophĂ€en von ihnen zu sammeln. So beginnt zwischen den beiden insgeheim, ohne daĂ der Rest der Welt wirklich versteht was passiert, ein in Etappen stattfindender telekinetischer Kampf auf Leben und Tod, der in einem verblĂŒffenden Showdown endet. Es ist bei weitem nicht nur der mit Detailtreue erschlagende und doch schwungvolle Strich von Otomo, dieser Mangastil mit unverkennbar westlicher FĂ€rbung, der âDomuâ zu einem echten Erlebnis macht; hier spielt der Meister zwar nicht zum ersten Mal, aber doch so beeindruckend wie nie zuvor mit cineastischer ErzĂ€hltechnik, mit Schwenks, krassen Schnitten, blutdruckpeitschenden Kombinationen von aufregenden Kamerapositionen. Auch wenn dieser Comic von 1980 ist, hat er bereits die filmtechnische Reife eines verdammt guten 90er Musikvideos. Alles, was spĂ€ter âAkiraâ so erfolgreich machte, ist schon da, aber hier nicht in einer Cyberwelt von morgen stattfindend, sondern direkt um die Ecke, im stinknormalen Alltag, und deshalb geht einem erst recht der Hut hoch. GerĂŒchte kursieren, daĂ Disney zur Zeit an einer Realverfilmung sitzt. Es kann einfach nicht so gut werden wie das Original. (Thomas StrauĂ) Lesetipps:
 Platz 32
Platz 32
Herrn Hases haarstrÀubende Abenteuer
Wenn man SchuhgröĂe 88 trĂ€gt, tappt man offenbar leichter in irgendwelche FettnĂ€pfchen. Die haben es in sich: da kriegt der groĂfĂŒĂige Held es schon mal mit dem uralten Fluch der TschnĂżptz-Dynastie zu tun, oder er wird plötzlich zum Direktor einer ĂŒberaus zwielichtigen Firma ernannt, oder die Bewohner einer abgelegenen Siedlung wollen ihn völlig grundlos kalt machen. Letztlich bleibt Herr Hase aber keine Antwort schuldig, denn obwohl er Ă€uĂerst friedliebend, mitfĂŒhlend, gerecht, ehrlich und mutig ist, aufs Maul gefallen ist er deshalb noch lange nicht. Seine Gegenwehr gegen die Schwierigkeiten der Welt besteht denn auch meist in Reden: die sind oft banal und alltĂ€glich, aber immer fein gewĂŒrzt mit französischem Esprit und manchmal mit abgrĂŒndigen AbsurditĂ€ten. Diese Reden im VerhĂ€ltnis zu den schrĂ€gen Ereignissen machen den Witz und den Charme der Hase-BĂ€nde aus. Allerdings wird man den Verdacht nicht los, dass Hase letztlich ein Schauspieler ist, der seine Abenteuer mit treuen Freunden, dem Kater Richard, dem Hund Titi, der Ratte Pol, der MĂ€usin Nadia, nachspielt. Denn in jeder Geschichte wechseln sie in ein anderes Genre: so ist âBlacktownâ ein Western, âSlalomsâ eine Skinovelle, der Krimi âWalterâ spielt Ende des 19. Jahrhunderts, âVerfluchtâ im modernen Paris. Und wie so mancher gute Regisseur sich selbst eine kleine Nebenrolle in sein Skript geschrieben hat, taucht auch Lewis Trondheim gern am Rande in seinen Hase-Geschichten auf. Will man dem in jedem Carlsen-Band abgedruckten PortrĂ€t Glauben schenken, sieht er einem schlecht gelaunten Vogel Ă€hnlich, und als solcher steht er schon mal auf der Vernissage eines Freundes von Herrn Hase herum. Lewis Trondheim, mit bĂŒrgerlichem Namen Laurent Chabosy, begann seinen Herrn Hase als 500-seitiges Monsterwerk (Lapinot et les carottes de Patagonie, bislang nur auf französisch bei LÂŽAssociation), das er nur zur Ăbung anfertigte, um Zeichnen und ErzĂ€hlen zu lernen. Das konnte er damals schon verdammt gut und inzwischen noch viel besser, auch wenn er sich heute meist auf gewöhnliche 48-Seiten-Geschichten beschrĂ€nkt. In manchen ZĂŒgen erinnern seine Zeichnungen vielleicht an Vorbilder wie HergĂ© und Franquin, bleiben aber immer unverwechselbar Trondheim, gerade in den witzigen Details wie den ungleich groĂen Augen â das eine ein Punkt, das andere kugelrund -, wenn mal wieder etwas grandios schiefgegangen ist. Eins ist jedenfalls ĂŒberhaupt nicht schiefgegangen. Herr Hase hat so etwas wie Kultstatus erlangt, und man darf ihn wohl getrost zu den modernen Klassikern im Funnies-Bereich rechnen. (Gerlinde Althoff) Lesetipps: Linktipps:
 Platz 33
Platz 33
Sgt. Rock
Schaut man sich die vorherrschende Schussrichtung in der allgemeinen Rezeption von Filmen, Romanen, Bildern, Comics etc an, in denen Krieg eine zentrale Rolle spielt, liegt der Schluss nahe, dass hier einem unhintergehbaren Dogmatismus die Fahne gehalten wird. Denn immer dann, wenn in Kunstwerken die Maschinengewehre ballern, die VerrĂ€ter baumeln und diverse StrĂ€nde, HĂŒgel und StĂ€dte genommen werden, meinen plötzlich alle ĂŒber Sinn und Unsinn von Kriegs- bzw. Antikriegskunst mitreden zu können. Menschen, die sich Minuten vorher noch die gröĂte ScheiĂe unkommentiert reingezogen haben, debattieren mir nichts, dir nichts darĂŒber, ob Milton Caniff, Fancisco Goya, Louis-Ferdinand Celine, Harvey Kurtzman, Akira Kurosawa, Ernst JĂŒnger und Joe Kubert nun in Wirklichkeit verkappte Faschisten und talentierte Nixblicker sind oder ob sie "die Schrecken des Krieges angemessen herausstellen". Hauptsache der Autor meint, Krieg ist blöd, dann ist alles prima und wir können wieder zu Bett gehen. Wissenschaftliche Versuche mit herkömmlichen Hermeneutik-Techniken haben jedoch ergeben, dass man Bob Kanighers (Text) und Joe Kuberts (Zeichnungen) steinhartem GI und seiner Truppe Easy Co. so nicht beikommen kann. Trotz MĂ€nnlichkeitswahn, Heldenkacke, Unrealismus, Klischee-Flut und Ă€hnlichem Kram, der einer Ideologiekritik nicht mal fĂŒr ein halbes Panel lang standhalten wĂŒrde, handelt es sich bei Kanighers liedartig strukturierten Sgt.-Rock-Geschichten (Strophe, Refrain, Strophe, Bridge, Refrain, Solo usw.), die von Kubert - den ich, zumindest was die sechziger Jahre angeht, fĂŒr einen der ganz GroĂen des Mediums halte - ohne Reibungsverlust umgesetzt werden, um Werke, vor denen jeder Comicfan, der was auf sich hĂ€lt, in Andacht niederzuknien hat. For those about to rock, we salut you! Interessierten empfehle ich, sich die hervorragende Anthologie-Reihe "Sgt. Rock Special" (zwischen 1988-91 erschienen) zu besorgen, die neben allerhand Kubert/Kanigher (u.a. "Enemy Ace") auch noch einige schönen Arbeiten vom ewig unterschĂ€tzten Russ Heath enthĂ€lt. (Marc SagemĂŒller) Lesetipps:
 Platz 34
Platz 34
Short-Stories
Angefangen hatte David Mazzucchelli 1984 als Superheldenzeichner bei Marvel: zunĂ€chst arbeitete er an âDaredevilâ, spĂ€ter an âBatmanâ (âDas erste Jahrâ). Dann verschwand er eine Weile in der Versenkung â um nachzudenken, wie gemunkelt wurde, und das, was dann folgte, bestĂ€tigte dieses GerĂŒcht. Im Verlauf der Arbeiten im Superhelden-Genre hatte er allmĂ€hlich einen eigenen, unverwechselbaren Stil entwickelt, und diesen findet man erstmals unverfĂ€lscht in den Kurzgeschichten, die er ab 1991 in seinem Magazin âRubber Blanketâ veröffentlichte. Drei dieser ErzĂ€hlungen hat die Edition Moderne auf deutsch in dem Band âDiscovering Americaâ vorgelegt. Alle sind zweifarbig ausgefĂŒhrt â z.B. schwarz-gelb oder rot-blau -, und entwickeln ihre fast magische Wirkung durch die expressive Grafik. Zu Recht verlĂ€sst sich Mazzucchelli ganz auf die Bilder. Geradlinig und beinahe wortkarg erzĂ€hlen sie von Menschen, in deren Alltag das Fremde, Unerwartete einbricht; in âBig Manâ ist es z.B. ein ganz unheldischer Riese mit SuperkrĂ€ften. In dieser Geschichte setzt sich Mazzucchellis auf ganz andere Weise mit dem Superhelden-Genre auseinander, immer wieder auch mit der Kommunikation ganz ungleicher Charaktere, und er erschafft dabei Parabeln auf grundlegende menschliche Befindlichkeiten. Leider versammelt âDiscovering Americaâ nur drei Geschichten, und die zeigen einen nachdenklichen und tiefsinnigen Autoren â der aber auch andere Seiten hat. So beweist die herrliche Geschichte âThe Death of Monsieur Absurdeâ (schwarz und hellgrĂŒn), dass Mazzucchelli auch Humor mit Hintersinn zu verbinden weiĂ. Eine weitere Seite dieses auĂergewöhnlichen Zeichners findet man in âStadt aus Glasâ. Mazzucchelli adaptierte die gleichnamige ErzĂ€hlung des Schriftstellers Paul Auster, in der es um die UnzuverlĂ€ssigkeit der Sprache geht und viel von berĂŒhmten literarischen Vorlagen (z.B. Miltons âParadise Lostâ) die Rede ist. Statt literarischer Zitate setzt Mazzucchelli nun visuelle Zitate ein: StadtplĂ€ne, Hinweisschilder, filmische Kamerafahrten, DĂŒrers Narrenschiff-Illustrationen und noch so einiges mehr werden virtuos durch reines Schwarz-weiĂ verknĂŒpft. Da verwandeln sich FingerabdrĂŒcke in Labyrinthe und KackehĂ€ufchen reden, und unter der vertrauten OberflĂ€che der Dinge verbergen sich mythische Welten. Und die Rechnung geht auf: wie die ErzĂ€hlung macht der Comic auf die BrĂŒchigkeit der Sprache aufmerksam â nur eben mit anderen Mitteln, und an vielen Stellen macht er darĂŒber hinaus sichtbar, wie es dazu kommt. David Mazzucchelli ist jedenfalls einer, von dem man noch einiges erwarten darf. (Gerlinde Althoff) Lesetipps:
 Platz 35
Platz 35
Pogo
âWenn Walt Kelly gut war, dann war er stets der Beste, den es gibtâ, befand das Comics Journal ĂŒber den Schöpfer von Pogo und eigentlich wĂ€re dem nichts hinzuzufĂŒgen, wenn Pogo in Deutschland nicht so gut wie unbekannt wĂ€re. Lediglich eine Handvoll Strips fanden ihren Weg in Carlsens Comics - Weltbekannte Zeichenserien-Anthologie und ein Sammelband erschien 1974. Kein Wunder, gelten doch Kellys semantische und phonetische Spielereien als nahezu unĂŒbersetzbar. Ab 1949 erschienen Kellys Geschichten ĂŒber den Okefenokee-Sumpf und als Pogo 1974 eingestellt wurde, war das Genre Comic Strip ein anderes, Kelly verwandelte ihn in groĂe Kunst. War Pogo zunĂ€chst noch ein funny animal-Strip, der eben nur etwas besser geschrieben war (Kelly legte schon frĂŒh Wert darauf, zu zeigen das Kommunikation nur ein Irrtum ist), so bezog er spĂ€testens ab 1953 Stellung gegen die Hexenjagd des berĂŒhmt-berĂŒchtigten Senators Joseph McCarthy. Auch spĂ€ter behielt Kelly diese kritische Haltung gegenĂŒber der amerikanischen Politik: J. Edgar Hoover, Spiro Agnew und Richard Nixon wurden die bevorzugten Zielscheiben seiner Satire. Aber auch kommunistische Diktatoren waren nicht vor der LĂ€cherlichmachung durch Pogo und seine Freunde gefeit: So traten Crustschow als Schwein auf und Fidel Castro als Ziegenbock auf. Bemerkenswert, daĂ lediglich die Titelfigur, das Opossum Pogo, zeit seines Lebens etwas blĂ€Ălich blieb, die restlichen 150 Haupt- und Nebenfiguren, allen voran Albert der zigarrerauchende Alligator, sind genau ausgetĂŒftelte Charaktere, deren unterschiedliches Naturell sich sogar in der Form der Sprechblasen und dem Lettering niederschlĂ€gt. (Lutz Göllner) Lesetipps:
 Platz 36
Platz 36
Okami (Lone Wolf and Cub)
Itto Ogami, der Scharfrichter des Shogun, wird Opfer einer bösen Intrige. Die HĂ€scher eines verfeindeten Clans ĂŒberfallen sein Haus und töten seine Familie â nur seinen kleinen Sohn kann er retten. Als er dann auch noch eines Attentats auf seinen Herrn beschuldigt wird, bleibt eigentlich nur noch der rituelle Selbstmord, doch die Liebe zu seinem Sohn ist stĂ€rker als sein Ehrenkodex, und so wird Ogami zum âOkamiâ, zum einsamen Wolf, der von nun an dazu verdammt ist, mit seinem Kind heimatlos durch die Welt zu irren und sein Leben als gedungener Mörder zu bestreiten. Schon 1970 erschien der âOkamiâ-Zyklus in Japan und wurde sehr schnell sehr erfolgreich â der Westen allerdings muĂte sich gedulden, bis 1987 der seinerzeit amtierende Comic-Ăbergott Frank Miller gestand, welcher Comic ihn wie kein anderer zu seiner neuen, gefeierten, dynamischen Linie inspiriert hatte. Mit von Miller neu gezeichneten Covern und einfĂŒhrenden Worten erblickte âOkamiâ unter dem Namen âLone Wolf and Cubâ das Licht des amerikanischen Markts und half, die westliche Welt aus ihrem Manga-Dornröschenschlaf zu erwecken. Selbst heutzutage sieht der 7000 Seiten starke Samurai-Epos von Kazuo Koike und Goseki Kojima immer noch reichlich modern aus. NatĂŒrlich, ein Ronin, der im Japan der Edo-Zeit einen Kinderwagen durch die Lande schiebt, das gibt es in diesem Genre nicht allzu hĂ€ufig zu sehen. Ebenfalls ganz gehörig aus dem ĂŒblichem Rahmen fallend ist der ĂŒppige Aufwand um AuthenzitĂ€t, mit der Koike und Kojima die Kultur des fernöstlichen Mittelalters vor unseren Augen wiederauferstehen lassen â egal, ob Deko oder Bekleidung, ob Philosophie der Zeit oder alltĂ€gliche Sitten und GebrĂ€uche; die Kulisse ist hier alles andere als schmĂŒckendes Beiwerk, sondern dermaĂen grundsolide durchrecherchiert, daĂ jedem Geschichtsforscher die TrĂ€nen der RĂŒhrung in die Augen steigen (Nicht-Japanologen können die Details in der deutschen Ausgabe anhand historischer Nachbemerkungen vertiefen). Doch vor allen Dingen: was âOkamiâ neben dieser opulenten Historien-Inszenierung nach all den Jahren immer noch so gut funktionieren lĂ€Ăt, ist das GespĂŒr seiner Autoren fĂŒr filmischen ErzĂ€hlrhythmus. In majestĂ€tischer BedĂ€chtigkeit wird der Leser in die Szenen eingefĂŒhrt; langsam und episch schwelt das Unheil heran, um sich schlieĂlich in ausgiebigen, wuchtigen Actionszenen zu entladen. Wenn dann in Zeitlupe die durch die Gegend wirbelnden Angreifer durch Okamis flirrendes Schwert erlegt werden, fĂŒhlt man sich wirklich wie im Kino. Apropos: natĂŒrlich verkauft sich ein Manga nicht ĂŒber 250 Millionen mal, ohne verfilmt zu werden. Schon 1972 machte Kenji Misumi aus der Saga des einsamen Wolfs eine sechsteilige Filmreihe. FĂŒr alle, die nach 8 BĂ€nden bei Carlsen erst so richtig auf den Geschmack gekommen sind, gibtâs âDas Schwert der Racheâ und âAm TotenfluĂâ bei One World Entertainment auf DVD. (Thomas StrauĂ) Lesetipps:
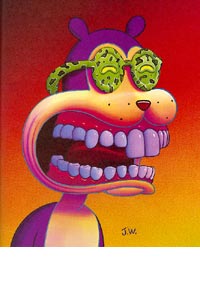 Platz 37
Platz 37
Frank
Als Michel Foucault Mitte der sechziger Jahre seine legendĂ€re ArchĂ€ologie der Humanwissenschaften "Die Ordnung der Dinge" veröffentlichte, konnte er noch nicht wissen, dass folgender aus diesem Werk stammende Satz sich einmal vollkommen richtig auf Jim Woodrings ab 1992 erscheinenden Strip Frank beziehen wĂŒrde: âSprache und Malerei verhalten sich zueinander irreduzibel: vergeblich spricht man das aus, was man sieht: das, was man sieht, liegt nie in dem, was man sagt; und vergeblich zeigt man durch Bilder, Metaphern, Vergleiche das, was man zu sagen im Begriff ist.â Woodrings Frank ist ein Wunderwerk an Ungreifbarkeit, ohne unzugĂ€nglich zu sein. Was die biberzahnige, keiner bestimmten Spezies ausser derjenigen der antropomorphen Cartoon-Tiere zugehörige Hauptfigur an einem Ort, wo Dekoration und Natur in welligen Linien und organischen Formen zu einer Art Landschaft zusammenlaufen, so treibt, ist schwer zu sagen. FĂŒr die (fast gĂ€nzlich stummen) Handlungen, Wesen und Dinge fallen einem keine Namen ein.Der Tiefgang ist bodenlos, liegt aber nicht âunterâ, âhinterâ oder âzwischenâ Woodrings wunderschönen, wie aus dem Nichts kommenden, weder abstrakten noch figurativen, naiven noch durchtriebenen Zeichnungen, sondern völlig klar, doch unerklĂ€rbar vor einem. Sicher ist nur: stellenweise ist Frank - bei aller Niedlichkeit - so gruselig, dass einem die Nase abfĂ€llt. (Sven-Eric Wehmeyer) Lesetipps:
 Platz 38
Platz 38
Feuer
Auf den ersten Blick könnte man es als das abhaken, wofĂŒr entsprechende Apologeten gerne die bundesverdienstkreuzgleiche Umschreibung âgraphische Literaturâ hervorpopeln: sich aufdringlich galerientrĂ€chtig gerierendes Gepinsel, das vornehmlich sein Artsyfartsytum abfeiert. Ăber einen solchen MiĂbrauch ist Mattottis Feuer von 1988 jedoch weit erhaben. Zwar liegt sein Stil nahe an Maltechniken, die unter diversen -ismen der Kunstgeschichte eingeschrieben sind (was ihn eben zum beliebten Vorzeige-Kunscht-Comic qualifiziert); doch wird hier nicht der angegammelte Heuristik-Zombie âBildspracheâ formuliert, sondern stattdessen, ganz comic-kompatibel, mit Bildern erzĂ€hlt. In der Geschichte des von den Gestalten, Feuern und Farben der geheimnisvollen Insel Sankt Agatha in Bann gezogenen Leutnant Absinth, die konsequent mit totaler Auflösung endet (Regression der Hauptfigur und Vernichtung des AufklĂ€rungskreuzers als Farb- und Formexplosionen), verunmöglicht die perfekt ausbalancierte Einheit von âInhaltâ, âBedeutungâ und Gestaltung die Reduktion auf den GemĂ€ldeaspekt; Mattotti schafft eine unaufgesetzt-ausgeglichene Unwirklichkeit, in der man ihm auch Farben als HandlungstrĂ€ger abnimmt. Ein visuell derart erschlagendes Experiment ist, wie an Mattottis sonstigen Arbeiten abzulesen ist, zur Einmaligkeit verurteilt. (Sven-Eric Wehmeyer) Lesetipps:
Platz 39 ItÂŽs a Good Life, If You DonÂŽt Weaken
Nachdem ich stundenlang in meinem Comicschrank forschungsmĂ€Ăig unterwegs gewesen war, sah ich dann doch meine Vermutung bestĂ€tigt, dass es sich bei Seths (Kanadier und guter Kumpel von Chester "The Playboy" Brown und Joe "The Poor Bastard" Matt) "ItÂŽs a Good Life, If You DonÂŽt Weaken" um den am meisten zuende gedachten (da kommt selbst Lewis Trondheim nicht mit) Comic ĂŒber AlltĂ€glichkeit bzw. das Leben an sich handelt. Zwar gibt es auch soetwas wie eine Story - Seth, der selber die Hauptrolle ĂŒbernimmt, macht sich auf die Suche nach einem verschollenen Zeichner/Karikaturisten namens Kalo, von dem er in alten Ausgaben des "New Yorker" einige wenige Bildchen entdeckt hat - doch wird hier das Prinzip, welches das Gros aller narrativen Kunst beherrscht, eine Geschichte mit Hilfe von Figuren erzĂ€hlen zu lassen, einfach umgedreht. Er benutzt die Handlung lediglich um sein Dasein unsymbolisch, unwitzig, straight arrangiert und mit einem absolut grandiosen, die Zeit einfrierenden, Zeichenstil auf 160 Seiten zusammenzufassen. Dabei ist es so piepenhange wie nur irgendwas, ob es diesen Kalo nun wirklich gegeben und ob Seths haarstrĂ€ubendes Indiana-Jones-Abenteuer autobiografisch, semiautobiografisch oder 1000%ig ausgedacht ist (ich erwĂ€hne das nur deshalb, weil im Zusammenhang mit "ItÂŽs A Good Life" immer und immer wieder darauf abgehoben wird (wahrscheinlich weil den Knilchen und Knilchinnen ansonsten nix besseres dazu einfĂ€llt)). Wer jetzt glaubt, dass das alles totaler Humbug ist, wie ihn nur eine Eierbirne ausbrĂŒhten kann, die schon zuviele Comics in ihrem Leben gelesen hat, der werfe doch mal einen Blick in "Clyde Fans", dem ersten Teil des Nachfolgers von "ItÂŽs A Good Life", wo ein Opa ca. 70 Seiten lang monologisierend durch seine olle Bude stiefelt... Bleiben am Schluss nur noch ein paar heiĂe Scheiben, die man in voll bekackter Hippietradition als Lese-Soundtrack empfehlen kann: Jimmy Giuffre: "1961", Frank Sinatra: "In The Wee Small Hours", Bill Evans: "Sunday At The Village Vanguard". Und ab dafĂŒr! (Marc SagemĂŒller) Lesetipps:
 Platz 40
Platz 40
Kabuki
In den 90ern ist in den US-Comics ziemlich wenig aufregendes passiert. Den Aufbruch, den Miller, Sienkiewicz und Chaykin angedeutet hatten, war lĂ€ngst abgeblasen worden. Im Mainstream und an dessen RĂ€ndern herrschte lautstarke Langeweile a la McFarlane, Lee & Co. Einer der wenigen, der dennoch versuchte neue Wege zu gehen, war David Mack. "Kabuki" ist zunĂ€chst einmal eine SF/Samurai-Story, die Geschichte einer Rache. Nicht wirklich originell. Aber wie Mack diese Geschichte erzĂ€hlte, war aufregend frisch und oft geradezu waghalsig. "Circle of Blood", eine in sechs Teilen veröffentlichte s/w-Graphic Novel, die den Kern der Story bildet, erschlĂ€gt in ihrer erzĂ€hlerischen Wucht. Auch wenn Mack spĂŒrbar mit anatomischen Fertigkeiten kĂ€mpft, sein Sinn fĂŒr Seiten-Design, Tempo, Kontemplation, sein GespĂŒr fĂŒr die innere Dramatik der Geschichte macht jeden Fehler im Detail wett. "Kabuki" ist eine verrĂŒckte, bestechende Mischung: eine pathetische stream-of-consciousness- Action-Tekno-Zen-Ballade, das Teil, das William Gibson immer schreiben wollte, aber nie konnte. Nach "Circle of Blood" verzettelte sich Mack. Kabuki lieĂ ihn nicht los oder er konnte nicht los lassen. Die Geschichte war erzĂ€hlt, was folgte war halbgares, lyrisches Geraune, das in kitschig collagierte GemĂ€lde eingebettet wurde â Poster-Artwork fĂŒr Kung Fu-Schulen und TeelĂ€den. Das macht ihn zwar zum einzigen KĂŒnstler, der auf den Spuren von Sienkiewiczâ "Stray Toasters" wandelt, aber von dessen wohlkalkuliertem Wahnsinn ist Mack Lichtjahre entfernt. (Bernd Kronsbein) Lesetipps:
 Platz 41
Platz 41
Green Lantern/Green Arrow
Mit Neal Adams ist das so eine Sache: Welches seiner Projekte verdient die Aufnahme in diese Liste? Ist es sein Batman, der den realistischen New Look des Dunklen Detektivs etablierte? Sind es seine X-Men, bei denen Adams mit Layouts experimentierte, bis Stan Lee selber die Notbremse zog und ganze Seiten von Marie Severin neu zeichnen lieĂ? Oder gar sein Superman, der sich zwar nur auf wenige Hefte, einen Haufen klassischer Titelbilder und den Sonderband âSuperman vs. Muhamed Aliâ beschrĂ€nkte, das Erscheinungsbild des StĂ€hlernen in den siebziger Jahren aber nachhaltig verĂ€nderte? Nein, Adams gröĂte Leistung bestand ohne Zweifel in seinem Green Lantern-Run, der von April 1970 bis Mai 1972 (mit vier Nachklappern im Flash) lief. Der ehemalige Journalist Denny OâNeil, gerade frisch zu DC gestoĂen, schrieb dem jungen Mann Szenarien, die vollkommen mit den alten Superhelden-Stories brachen. Gleich im ersten Heft, der Nummer 76, muĂ Hal (Green Lantern) Jordan gegen einen fiesen Hausbesitzer antreten, der mit legalen Methoden seine Mieter terrorisiert. Sehr zum MiĂtrauen seiner Chefs, der WĂ€chter von Oa, denn diese schicken einen Aufpasser auf die Erde. Gemeinsam mit seinem Kumpel Green Arrow und verfolgt von dessen Freundin Black Canary macht sich die kleine Gruppe auf eine Reise durch Amerika - und entdeckt einen fremden Kontinent, beherrscht von Rassismus, Intoleranz und LĂŒgen, ökologisch verwĂŒstet, mental zerstört, die Aufbruchstimmung der Kennedy-Ăra ist dem Vietnam-Kater gewichen. Die Reise endet in einem seitenlangen Kampf zwischen der âkonservativenâ Laterne und dem âprogressivenâ Pfeil, der mit einem Text aus Norman Mailers brillanten Reportageroman âHeere aus der Nachtâ unterlegt ist, nur um sich in den nĂ€chsten Heften den Themen Ăberbevölkerung, Drogensucht und Sekten zuzuwenden. UnterstĂŒtzt von den Young Guns Mike Kaluta und Bernie Wrightson legen OâNeil/Adams bis zur Nummer 89 (einzig Heft 88 war nicht von ihnen) eine Serie hin, die geprĂ€gt ist vom Zeitgeist dieser Jahre und gaben den Superhelden-Comics damit erstmals soziale Relevanz. Die bittere Pointe freilich sollte man nicht verschweigen: Adams und OâNeil betreuten mit Green Lantern eine siechende Serie und durften deshalb experimentieren. Allein: Es half alles nichts, nach der Nummer 89 wurde das Heft wegen mangelnder Verkaufszahlen und trotz hervorragender Kritiken eingestellt. (Lutz Göllner) Lesetipps:
 Platz 42
Platz 42
Alack Sinner
âWas fĂŒr eine Stadt! Wer hier lebt, darf sich ĂŒber nichts wundern. Die Dinge geschehen einfach...â Diese Stadt heiĂt New York, und einer, der hier lebt, ist Alack Sinner, Ex-Polizist und Privatdetektiv. Sich Wundern paĂt nicht zu seinem Beruf - sein Job ist es, Antworten zu finden, bisweilen auch auf Fragen, die man ihm gar nicht gestellt hat, kurz: FĂ€lle zu lösen. Das hilft ihm, finanziell ĂŒber die Runden zu kommen, und mehr als einmal rettet es ihm auch selber den Hals. Aber es liefert ihm keine ErklĂ€rungen in seinem wichtigsten Fall: seinem eigenen. Er ist sich seiner GefĂŒhle selten bewuĂt - seine Ăngste verdrĂ€ngt er, bis sie als abgrĂŒndige Traurigkeit wiederkehren, die er nur zu oft in Alkohol ertrĂ€nkt. Dabei fressen ihn Egoismus, Skrupellosigkeit, BrutalitĂ€t um ihn herum innerlich auf, und er sehnt sich nach echter Freundschaft. Aber zugleich auch nach seiner Einsamkeit. Dieser Mann ist zwar ein verdammt guter Privatdetektiv, weil er etwas herausfinden will (vielleicht sogar muĂ). Doch er sagt von sich selbst, daĂ er die Welt nicht aus den Augen eines SpĂŒrhundes sieht, sondern âmit dem Blick eines SĂŒndersâ. Deshalb ist er keiner von all den zynischen SchnĂŒfflern, die andauernd coole SprĂŒche absondern, etwa ĂŒber ihr Jagdrevier und ihre Opfer. Er weiĂ einfach auch, daĂ es ihn in dieser Stadt an jeder Ecke erwischen kann, jederzeit, aus nichtigstem AnlaĂ. Da bleibt kein Platz fĂŒr Eitelkeit.... âVerdammte, dĂŒstere Stadt!â Im flĂ€chigen SchwarzweiĂ des Exil-Argentiniers JosĂ© Muñoz (der sein Handwerk bei Alberto Breccia und Hugo Pratt erlernte) wird es sowieso nie richtig Tag. Und dazu sind die Bildausschnitte oft derart gedrĂ€ngt, die Perspektiven gewagt, daĂ sich immer wieder GefĂŒhle klaustrophobischer Enge, einer latenten Bedrohung einstellen. Die Bilder werden zudem in dem MaĂe dĂŒsterer, in dem auch die ErzĂ€hlungen von Muñozâ Landsmann Carlos Sampayo immer auswegloser erscheinen. Sie dokumentieren nicht nur Sinners allmĂ€hlichen Abstieg, seine zunehmende innere Verzweiflung. Sie belegen dazu den Niedergang einer wie auch immer gearteten Hoffnung auf revolutionĂ€re Befreiung im Laufe der 70er Jahre, die mit Black-Panther-Militanz z. B. begannen und im reaktionĂ€ren Backlash der Reagonomics endeten. Selbst die Graphik dokumentiert diesen Wandel: vom prĂ€zisen Strich zu Beginn (1975) mit sozialkritischem Interesse binnen weniger Jahre zur drastischen Karikatur, die ein groteskes Panoptikum dekadenter US-Massenkultur entwirft. OhnmĂ€chtige Wut spricht aus diesen spĂ€teren Folgen. Alack Sinner aber sagt weiterhin: âJe brutaler die Stadt sich zeigt, um so mehr gefĂ€llt sie mir. Ein widersprĂŒchliches GefĂŒhl, aber nur so wird sie fĂŒr mich lebendig, kann ich ihre Gesetze achten und auf Antworten hoffen, die sie fĂŒr mich bereithĂ€lt.â Er wird weiter suchen, weiter leiden. Und den Widerspruch vermutlich nicht lösen... (Martin Budde) Lesetipps:
 Platz 43
Platz 43
Blueberry
Ganz entgegen seines Rebellen-Images ist Blueberry ein ziemlicher Anpasser: 1965, der Western ĂĄ la John Ford war gerade im Untergang, debĂŒtierte er in Fort Navajo ganz klassisch als leicht gebrochener, aber durchweg positiver Held; Anfang der siebziger Jahre, auf dem Höhepunkt der Italo Western-Welle, kĂ€mpfte sich auch Blueberry zĂ€h durch eine dreckige und fiese Welt, die ihm schlieĂlich alles nahm, Rang, Namen und vermeintlich sogar das Leben; und seine RĂŒckkehr in den Achtizern wurde im Kino begleitet von einer kleinen, aber feinen Renaissance des Westernfilms. Doch was Blueberry zu so einer bemerkenswerten Serie (dem besten Western in diesem Medium) macht ist, daĂ er bei aller Anpassung an den Zeitgeist immer eine zutiefst eigene Schöpfung des Texters Jean-Michel Charlier und seines Zeichers Jean Giraud geblieben ist. Das macht Blueberry zu einer Ausnahme in der Karriere des Vielschreibers Charlier und nicht umsonst ist dies die einzige Konstante in der nun schon 40 Jahre dauernden - und an Tiefpunkten nicht gerade armen - Karriere Girauds, die einzige Serie, zu der er immer wieder zurĂŒckkehrt. Es scheint, als hĂ€tte sich hier eine Figur ihre Biografen selber ausgesucht. Selbst die Versuche anderer, weniger begabter, Autoren und Zeichner konnte dem Nimbus der Serie nichts anhaben. Fraglich ist nur, ob Giraud, der nun auch schon im Rentenalter ist, seinen Plan wahrmachen kann, das Leben des Mike Steve Blueberry von seiner Geburt 1843 bis zu seinem Tod im Jahr 1933 (die Parallelen zu Pratts Corto drĂ€ngen sich auf) zu erzĂ€hlen. (Lutz Göllner) Lesetipps:
 Platz 44
Platz 44
Short Stories
Dem Horror-Genre haftet in besonderem MaĂe das an, was Stephen King den âLaĂ-mich-dein-gekautes-Essen-sehenâ-Faktor nennt: kindliche Schau-und Zeigensfreude dessen, was verrottet, sobald Licht darauf fĂ€llt; Spielereien mit OberflĂ€che und Material zuungunsten kĂŒnstlerischer Ăkonomie; Schrecken plus SpaĂ minus Scham. Obwohl all das so einfach klingt, gibt es im Bereich expliziten, phantastischen Horrors nur wenig wirklich ĂŒberzeugende Werke. Im Medium Comic steht, historisch und stilistisch der EC-Terrorkanone Graham âGhastlyâ Ingels nachfolgend, an einsamer Spitze Berni(e) Wrightson. Sein Horror ist vollsaftig, körperlich und von hemmungslos ausformulierter, barocker Ăppigkeit. Alles wird gezeigt, ist eklig, finster und lustig, aber immer geschmackvoll, trotz oder gerade wegen der Einzelbilder abfeiernden Brechstangen-AtmosphĂ€re, der ĂŒberverzerrten Gummi-GliedmaĂen und des liebevoll manieristisch umkauerten, immergleichen Monstren-und Plotarsenals. Höhepunkt im Oeuvre, zumindest unter comic-orientierten Gesichtspunkten, sind die Stories, die Wrightson, nach seinem Swamp Thing-Durchbruch bei DC, zwischen 1974 und 1976 - z.T. in Kooperation mit anderen Autoren - fĂŒr Jim Warrens s/w-Horrormagazin Creepy schuf: nach dem DebĂŒt The Black Cat folgten neben weiteren Poe- und Lovecraft-Adaptionen solche Kracher wie The Muck Monster, Bernis Frankenstein-PropĂ€deutik, die Loch-Ness-Variation The Pepper Lake Monster, kleine mit EC-Pointen versehene Fiesheiten wie The Laughing Man oder Nightfall und, als Höhepunkt und ultimative femme fatale-Exploitation, Jenifer. Eine Schande, daĂ z.Zt. keine s/w-Auswahl dieser Eyeslasher greifbar ist. (Sven-Eric Wehmeyer) Lesetipps:
 Platz 45
Platz 45
Fantastic Four
Das Werk von Jack Kirby kann mit einem einzigen Wort charakterisiert werden: Energie! UngebĂ€ndigte visuelle wie erzĂ€hlerische Energie, gepaart mit einer Fantasie, die im Laufe von ĂŒber 50 Jahren wahre Herscharen von Helden geboren hat: Von Captain America ĂŒber den Hulk, die X-Men bis zum Silver Surfer. Kirby wurde zum Epizentrum des gesamten amerikanischen Comicmarktes. Den Höhepunkt bilden unbestritten die Hefte der Fantastic Four, die er gemeinsam mit Texter Stan Lee in den 60er Jahren schuf. In ihnen entwickelte er seine graphische ErzĂ€hltechnik zur Perfektion und brillierte mit dem, was bald zu seinem Markenzeichen wurde: ĂberlebensgroĂe, gottgleiche Figuren, die KĂ€mpfe von galaktishen AusmaĂen ausfechten. In den Fantastic Four findet Kirby den idealen Partner, der auf der einen Seite grandios-kosmische Texte auf den Leib dichtet, auf der anderen Seite aber auch immer darauf achtet, dass die Helden fest im normalen Leben und seinen trivialen AlltĂ€glichkeiten verankern bleiben. KirbyÂŽs Zeichnungen strotzen vor Kraft und Dynamik. Wie kein zweiter beherrscht er die visuelle Sprache des Mediums Comic. Korrekte Anatomie oder Perspektive ordnen sich dem einen Ziel unter, eine Geschichte zu erzĂ€hlen, und dies so eindringlich und ĂŒberzeugen wie nur irgend möglich. HierfĂŒr erfand er die ganzseitige splash-Panels, arbeitete mit Collagen und entwickelte eine von starken schwarz-weiĂ-Kontrasten dominierte Darstellungsweise. Neben der Saga um die Fourth World, die unmittelbar im Anschluss entstand, zĂ€hlen Jack Kirbys und Stan Lees Fantastic Four zum besten, was der amerikanische Mainstream-Comicmarkt hervorgebracht hat. Alles danach ist nur eine FuĂnote zu Kirby. (Cord Wiljes) Lesetipps:
Platz 46 Preacher
Es gibt nur einen Comic, fĂŒr den Hardcore-Redneck-Chronist Joe R. Lansdale oder Clerks / Chasing Amy - Regisseur Kevin Smith Vorworte schreiben, der seinem Hype wirklich standhalten kann, dutzendfach die Momente perpetuiert, die die gröĂten Spaghettiwestern groĂ machen, Dialoge bietet, wie sie Quentin Scorsese kaum hĂ€tte schreiben können, mit einem Prediger auf der Suche nach Gott, John Wayne, Engeln, dem Heiligen der Killer, einem Vampir, einer Gralssekte und ĂŒbelstem Backwoodabschaum, der splattert wie Ziege und derart Kette gibt, dass...was soll man sagen? Der Preacher macht seine Gemeinde sprachlos, indem er sie derart zupredigt, dass die Kirche explodiert â was in der Exposition exakt so stattfindet. Denn hier geht es nicht darum, auf Deubel komm raus âTabus zu brechenâ (oder wie auch immer die Formeln lauten mögen, mit denen feuilletonistische Geistlosigkeit ihre engen Schubladen beklebt), sondern in erster Linie darum, der höchsten Kunst des Dialogs zu frönen. Ăber die Unmenge an dreiĂ€ugigen WĂŒstenkannibalen, französischen Pferdefressern und kackenden Wurstfetischisten, die das Bild der Serie gegen Ende hin zunehmend prĂ€gen, sollte man dabei hinwegsehen können, ebenso wie ĂŒber EnnisÂŽ gelegentliche Ăbungen in Infantil-Atheismus. Politische Kritik prallt am Preacher jedenfalls ab wie Kugeln vom Heiligen der Killer. Sollte man in der Home-Bibliothek zwischen James Ellroy und Oscar Wilde einordnen. (Sven-Eric Wehmeyer) Lesetipps:
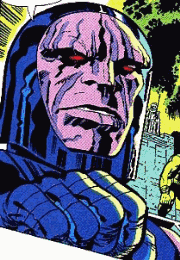 Platz 47
Platz 47
Fourth World
Eine moderne Mythologie fĂŒr das 20. Jahrhundert: Jack KirbyÂŽs Saga um die Fourth World ist ein breit angelegtes Epos, das den Ă€onenalten Kampf des Guten gegen die MĂ€chte der Finsternis in die Jetztzeit transferiert. Nach dem Tod der alten Götter entstanden aus den Ruinen zwei neue Welten der New Gods. Auf der einen Seite New Genesis, die Welt des Schönen und des Lichts, gefĂŒhrt von Highfather, dem Weisesten der Göttter. Auf der anderen Seite Apokolips, die Welt der Feuergruben und der Para-DĂ€monen, mit eiserner Hand beherrscht vom Tyrannen Darkseid und seinen dunklen Vasallen. Als Jack Kirby 1970 im Unfrieden von seinem langjĂ€hrigen Stammverlag Marvel zum Konkurrenten DC wechselte, bot sich ihm erstmalig die Möglichkeit, seine Geschichten auch eigenstĂ€ndig schreiben zu können. Er ĂŒbernahm zeitgleich die vier Reihen SupermanÂŽs Pal Jimmy Olsen, New Gods, Mister Miracle und Forever People, und verschmolz sie zu einer vielschichtigen und facettenreichen Gesamtgeschichte. Jack Kirbys Werke waren schon immer ĂŒberlebensgroĂ, aber in den Fourth World Titeln, insbesondere im Flaggschiff New Gods, lieferte er sein MeisterstĂŒck ab. Eine solche FĂŒlle an Göttern, Mysterien, fremden Welten und Abenteuern braucht den Vergleich mit der griechischen Mythologie und den nordischen Göttersagen nicht zu scheuen. Das Werk ist durchzogen von einer tiefgreifenden Symbolik, deren Interpretation ganze Doktorarbeiten fĂŒllen wĂŒrde: Der böse Darkseid sucht nach der "Anti Life Equation", einer Formel fĂŒr Kontrolle und Ordnung, nicht fĂŒr Zerstörung. Der Todesengel der Götter ist ein schwarzer Skifahrer (!). Die Götter haben ihren eigenen Gott: Die Quelle der Weisheit, genannt "the source". Und bei aller kosmischen Grandezza gelingt es Kirby doch zugleich, die Handlung ĂŒberzeugend mit dem Leben ganz normaler Menschen zu verknĂŒpfen, die mit den Göttern in BerĂŒhrung kommen und die dabei Grundlegendes ĂŒber sich und die Welt erfahren. Leider fand die Fourth World nie einen Abschluss. Nach nur zwei Jahren stellte der Verlag die Titel abrupt ein, angeblich wegen zu geringer Verkaufszahlen. Der Versuch, nachtrĂ€glich mit der Graphic Novel Hunger Dogs einen Abschluss zu setzen, blieb erzĂ€hlerisch wie kĂŒnstlerisch unbefriedigend. Es ist dies eine Tragik, die Jack KirbyÂŽs Werk mit vielen anderen der Kunst- und Musikgeschichte verbindet. Aber auch in der jetzigen Form ist Jack KirbyÂŽs "Unvollende" eine der herausragenden Einzelleistungen der Comicgeschichte. (Cord Wiljes) Lesetipps:
Kin-der-Kids/Wee Willie Winkieâs World
Lyonel Feininger (1871-1956) gilt heute als anerkannter Vertreter der klassischen Moderne, mit seinen Ă€therisch-kristallinen Werken angesiedelt zwischen Kubismus und Bauhaus ein fester Bestandteil des bildungsbĂŒrgerlichen Kalenderrepertoires. Aber wahrscheinlich weiĂ man dort wenig von seinen AnfĂ€ngen als Karikaturist und vermutlich gar nichts von seiner (kurzen) Comic-Karriere. Dabei hĂ€tte es ohne diese den KĂŒnstler Feininger womöglich gar nicht gegeben. Feininger wurde als Sohn eines deutschstĂ€mmigen Konzertmusikerpaares in New York geboren und kam mit 16 zurĂŒck in das Land seiner Eltern, um Violine zu lernen. Statt dessen widmete er sich lieber dem Zeichnen, besuchte in Berlin die Kunstakademie und begann dort, Illustrationen in diversen Humormagazinen zu veröffentlichen. Seine Themen variierten zwischen harmlosen Witzbildern und politischen Karikaturen, deren Themen allerdings von den Redakteuren der BlĂ€tter, fĂŒr die er arbeitete, vorgegeben wurden. Sein Interesse galt ohnedies mehr der kĂŒnstlerischen Ausarbeitung dieser Sujets, und sein graphischer Stil orientierte sich zunehmend an FlĂ€che und kantigen Konturen mit deutlichem Hang zur Groteske, was ihm schon in der Kritik um die Jahrhundertwende erste Beachtung einbrachte. Mit diesem Renommee und vielleicht dank des Umstands, daĂ er gebĂŒrtiger US-Amerikaner war, gelang ihm 1906 der Sprung zurĂŒck ĂŒber den GroĂen Teich. Dort waren mittlerweile die Comics dabei, sich zu etablieren - argwöhnisch betrachtet aus zweierlei GrĂŒnden: zum einen witterten die âbesseren Kreiseâ in ihnen wegen ihres hĂ€ufig derben Humors eine Gefahr fĂŒr Anstand und Sitte. Zum anderen muĂte gerade die gutbĂŒrgerliche Presse feststellen, daĂ die Boulevardzeitungen ihr eben dank dieser Comics massive EinbuĂen bereitete. So entschloĂ man sich ebenfalls zur Veröffentlichung von Comics, aber möglichst mit Niveau. Die âChicago Tribuneâ hatte dazu im April 1906 einen ganz besonderen Einfall: Man kĂŒndigte eine Sonntagsbeilage an, die nur von deutschen Zeichnern bestritten werden sollte, darunter Karl Pommerhanz, Lothar Meggendorfer und eben auch Feininger. Um es kurz zu machen: kommerziell wurde es ein drastischer Flop, was nicht zuletzt daran lag, daĂ keiner der Zeichner, Feininger inbegriffen, der die Entwicklung der Comics in den zehn Jahren zuvor wohl auch kaum mitbekommen haben wird, eine Vorstellung von den Erwartungen ihres US-Publikums hatte. Lyonel Feiningers Beitrag bestand immerhin aus einem echten Comic mit dem etwas seltsamen Titel âThe Kin-der-Kidsâ. In dem guten halben Jahr, in dem die drei Kids Daniel Webster, Teddy und Piemouth in der âTribuneâ erschienen, kreuzten sie in ihrer Familienbadewanne ĂŒber das Meer, landeten in England und strandeten im zaristischen RuĂland, dabei verfolgt von der âgutenâ Tante Jim-Jam samt Cousin Gus und einer Familienflasche Rizinusöl sowie gelegentlich geleitet bzw. gerettet von Mysterious Pete, dessen Rolle genauso mysteriös bleibt, wie es sein Name verspricht. GrĂŒnde fĂŒr diese Odyssee in der Badewanne, gar ein eigentliches Thema hatten die âKin-der-Kidsâ nicht. Sie begnĂŒgten sich mit der skurrilen Basiskonstellation und zahlreichen noch groteskeren Einlagen. Die turbulente Verfolgungsjagd, die sich dabei wie von selber ergab, fĂŒhrte allerdings eine echte Neuerung in die Comic-Historie ein: richtige Fortsetzungsstrips hatte es bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegeben! Nimmt man dazu noch Feiningers meisterliche Seitenaufteilung und seinen plakativen Umgang mit FlĂ€chen und Farbe, so sind die âKidsâ schon ein kleines Comic-Juwel. Sein wahres MeisterstĂŒck lieferte Feininger bei der âTribuneâ jedoch mit âWee Willie Winkieâs Worldâ ab - kein Comic, aber eine traumhafte Serie von kurzen Bildergeschichten mit Prosatexten, in denen die Metamorphosen diverser Landschaften aus der Sicht eines kleinen, phantasievollen Jungen geschildert werden. HĂ€user bekommen Gesichter, BĂ€ume, Wolken werden zu phantastischen Gestalten, Naturgeistern gleich, und GegenstĂ€nde rund um den Kamin stecken plötzlich voller Leben. UrsprĂŒnglich als Nebenserie zu den âKin-der.Kidsâ erstmals am 19. August 1906 erschienen, lief Klein-Willies phantastische Welt noch nach deren abrupter Absetzung am 18. November hinaus bis Anfang 1907, dann war Feiningers amerikanisches Abenteuer endgĂŒltig beendet. Der hatte sich unterdessen von dem Honorar der âTribuneâ selbst einen Wunschtraum erfĂŒllt und einen Studienaufenthalt in Paris leisten können, nach dessen Ablauf er zwar wieder sporadisch in Berlin als Witzzeichner tĂ€tig wurde. Aber der Grundstein zu seiner KĂŒnstlerkarriere war damit gelegt, und so hatten von seinem Comic-Intermezzo letztlich alle Seiten profitiert: die âChicago Tribuneâ erfuhr, wie man Comics besser nicht macht, sofern sie kommerziell erfolgreich sein sollen. Und die Comic-Nachwelt hat, Jahrzehnte spĂ€ter, einen Schatz entdeckt, mit dem sie sich zu Recht schmĂŒcken darf. Der kĂŒnstlerische Rang der âKin-der-Kidsâ und von âWee Willie Winkieâs Worldâ ist heute unstrittig und topaktuell. (Martin Budde) Lesetipps:
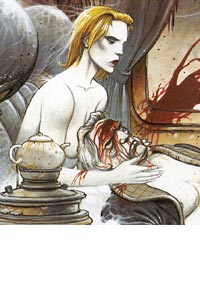 Platz 49
Platz 49
Treibjagd
FĂŒhrende ParteifunktionĂ€re des Warschauer Pakts kommen im verschneiten Polen in einem abgeschieden gelegenen Hotel zusammen, um eine gemeinsame Jagdpartie zu veranstalten. Die Biographien der Protagonisten werden vor dieser Kulisse entrollt, bis nach diversem erlegten Wild ein politisch motivierter SchuĂ einen Genossen trifft. Man fĂ€llt fast in einen seltsamen Zustand devoter Ehrfurcht, wenn man Pierre Christins (Szenario) und Enki Bilals (Graphik) 1983er Albumepos Treibjagd aufschlĂ€gt. Es ist der Gipfel ihrer Zusammenarbeit, das Finale der gemeinsamen, in den Siebzigern gestarteten Reihe der Heutigen Legenden und damit auch kulturhistorisches Dokument, denn ĂŒber das Medium hinaus markiert Treibjagd einen Endpunkt idealistischer Programmatik als ZusammenfĂŒhrung linker Agitation und Ă€sthetischer Strukturprinzipien. Es geht nicht nur um den in Fiktion gegossenen Niedergang des real existierenden Sozialismus, sondern auch um den Verlust der Möglichkeit, solche âStoffeâ auf eine solche Art zu behandeln. Vor allem öffnet Bilals Kunst, nicht ĂŒberbietbar in ihrer ungeheuer plastischen, dĂŒsteren Farbigkeit, den Ăberblenden, groĂen Symbolen, dem fast altmodischem Ernst und dem kaltem, erstarrten Pathos, einen Raum ganz in sich verschlossener, sich ihrer BrĂŒchigkeit bewuĂten AtmosphĂ€re. Sehr achtziger, sehr groĂ. (Sven-Eric Wehmeyer) Lesetipps:
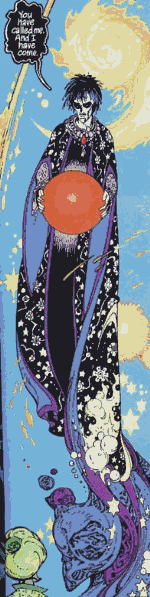 Platz 50
Platz 50
Sandman
Hierzulande denkt man bei âSandmanâ vielleicht an das kullerĂ€ugige MĂ€nnlein, das abends im Dritten Traumsand verstreut und den Kindern harmlose Gutenachtgeschichten erzĂ€hlt. Oder vielleicht noch an den grausamen Sandmann von E.T.A. Hoffmann. Neil Gaimans Sandman hat zum GlĂŒck von beiden etwas. Knapp 2000 Seiten berichten von der Gefangennahme, den Abenteuern und dem Reich des Traumwebers, knapp 10 Jahre haben Gaiman und verschiedene Zeichner daran gearbeitet. Was soll man in wenigen Zeilen ĂŒber dieses ausufernde, weit verzweigte Universum sagen, das etliche Preise erhielt und zahlreiche Ableger gezeugt hat â Comicreihen wie âLuziferâ, âMervyn Pumpkinheadâ, âDeathâ u.a.m.? Das Beste von allem ist vielleicht, dass Gaiman am Ende die vielen FĂ€den, die er ĂŒber die Jahre spann, zu einem ordentlichen Strick verdreht und Morpheus, den Herrn der Geschichten, von den Furien in den Tod hetzen lĂ€sst. Marc Hempel hat die Geschichte vom Tod des Sandman (The Kindly Ones; dt. Die GĂŒtigen) mit expressiven, luziden Bildern versehen, in denen jeder Strich sitzt. Die Schlichtheit seiner Kompositionen lĂ€sst der ErzĂ€hlung den breiten Raum, den sie braucht, denn Gaiman erzĂ€hlt höchst komplex und temporeich, immer mit einem postmodernen Augenzwinkern auf den Vorgang des ErzĂ€hlens selbst hin, eine Tragödie, in der sich wilde Rache, wahre Liebe und mythische Gestalten aller LĂ€nder ein Stelldichein geben. Wenn man die Geschichte des Sandman verfolgt hat, ist man vielleicht von Hempels gĂ€nzlich andersartigen Bildern zunĂ€chst schockiert, trifft aber all die herrlich skurrilen Bewohner des TrĂ€umens und der Wachwelt wieder, die man schon aus frĂŒheren Episoden kannte: den qualmenden KĂŒrbiskopf Mervyn, den Raben Matthew, Lyta Hall, die ihren Sohn Daniel mit einem Untoten zeugte, die seit Jahrtausenden lebende Hexe Thessaly, den Augen fressenden Alptraum Korinther; auĂerdem Elfen, die Götter Thor und Loki, Luzifer und viele andere. Und alle spielen ihren Part beim Untergang. Und irgendwann stellt man fest: Hempels Illustrationen in ihrer traumhaften Klarheit sind die einzig angemessenen, Gaiman zeigt sich von seiner besten Seite. Obwohl diese Geschichte ein Genuss in sich ist: so richtig goutieren kann man sie erst, wenn man auch die Vorgeschichte(n) kennt, die in den frĂŒher erschienenen BĂ€nden erzĂ€hlt wurde(n). Da hilft nur eins: selber lesen - und nicht vergessen: Schöne TrĂ€ume! (Gerlinde Althoff)
 Platz 51
Platz 51
Black Hole
Angst vor dem Tod, Angst vor dem Leben. Charles Burns beschĂ€ftigt sich eigentlich immer mit demselben Thema. In "Black Hole" bringt der US-Comic-KĂŒnstler es jedoch so genau auf den Punkt wie noch nie zuvor in seiner langen Karriere. Zuvor schrieb und zeichnete er vor allem brillante Kurzgeschichten, die immer ein wenig den Geist der EC-Comics atmeten. "Black Hole" aber ist groĂ angelegt, so groĂ, dass es immer noch nicht abgeschlossen ist. Jedes Jahr kommen ein bis zwei neue Hefte hinzu. Am Ende sollen es wohl 12 werden. Aber egal. Was vorliegt, ist so gut, dass es in diese Liste gehört. Erstmals lĂ€sst sich Burns auch Zeit, die Tiefen seiner Charaktere auszuloten, gibt er seinen Lesern Gelegenheit, Protagonisten wirklich kennenzulernen. Wo bislang Abstraktion und KĂ€lte wie ein Schutzschild die volle Wucht der Bilder und Geschichten abfederten, so verleiht die Ăffnung in Richtung EmotionalitĂ€t "Black Hole" eine wesentlich direktere und beunruhigendere Wirkung. Alles ist da, was man von Burns kannte: Teenager, Sex, Krankheiten, Mutationen. Diesmal hat man aber keine Chance mehr, sich zu entziehen. "Black Hole" ist eine grandiose Lektion in Paranoia. Fuck off, David Lynch! (Bernd Kronsbein) Lesetipps:
 Platz 52
Platz 52
Zoo
Der schönste Titel, den der dahingeschiedene Splitter-Verlag die Ehre hatte, in seinem Programm haben zu dĂŒrfen, war Franks und Bonifays ZOO. ZOO, ein Dreiteiler, dessen erster Band 1996 und dessen zweiter erst vor kurzer Zeit (in Frankreich) erschienen ist, spielt am Vorabend des ersten Weltkrieges und erzĂ€hlt von einem ehemaligen Arzt, dessen Hobby sein eben errichteter Zoo ist. Er muĂ ihn winterfertig machen und engagiert dafĂŒr Zigeuner. Die Zigeuner ziehen nach getaner Arbeit weiter, nur eine Frau bleibt. Eine Frau ohne Nase. Die Folge eines Eifersuchtsdramas. Der Arzt hat eine junge Tochter und einen Angestellten. Die haben beide noch ihre Nasen, aber ein VerhĂ€ltnis untereinander. Die Frau ohne Nase beobachtet sie. EifersĂŒchtig? Frank erzĂ€hlt ZOO ausschlieĂlich ĂŒber die AtmosphĂ€re. Ein Comic der Stimmungen und Andeutungen. Nichts wird an- oder gar ausgesprochen und dennoch ist der Leser verunsichert. Er verliert den Boden unter den FĂŒĂen, traut der Geschichte alles zu. Er fĂŒhlt sich verunsichert, ohnmĂ€chtig ob der unheilschwangeren AtmosphĂ€re. Wird etwas passieren und was wird passieren? Es ist der Phantasie des Betrachters ĂŒberlassen, welche Antwort er auf diese Frage findet. Er kann auch einfach darauf warten, welche Antwort Frank geben wird. Dem ist alles zuzutrauen. (Ingo Stratmann) Lesetipps:
 Platz 53
Platz 53
Die GefÀhrten der DÀmmerung 3: Das Fest der Narren
Ein Album, fĂŒr das einem leicht Superlative von den Lippen gehen. Irgendwie sind sich auch alle einig: Gewaltig, monumental, atemberaubend, ein Monster von einem Buch. Aber jeder setzt nach: Und worum zum Teufel geht es eigentlich? An der OberflĂ€che ist alles klar: Der dritte Teil einer Trilogie, die als sperrige Fantasy begann und als sperriges Historien-Spektakel endet. Eine Darstellung des Mittelalters, die man so unverklĂ€rt noch nicht gesehen hat, mit Blut, ScheiĂe, Pisse, Eiter, Sperma, Dreck und noch mehr Dreck. Die Geschichte spielt einige Tage um Weihnachten herum, aber dieses Fest hat nur wenig mit dem zu tun, was wir heute kennen. "Aberglaube" und "Glaube" liegt in einem Wettstreit, unter dem alles Weltliche blutig leidet. Der ganz normale Pöbel ist Freiwild fĂŒr jeden, der in der Hierarchie der Gesellschaft ĂŒber ihm steht. Aber er metzelt sich auch gern mal gegenseitig nieder. Gesellschaft? Zivilisation? Die Worte fallen einem irgendwie schwer. Die AtmosphĂ€re bedrĂŒckend zu nennen ist eine starke Untertreibung. Ăber dem Buch lastest eine permanente Todesdrohung, die fast greifbar wirkt. Das notgeile Verhalten der Protagonisten wirkt da fast wie ein Ăberlebensinstinkt (wenn man nicht wĂŒĂte, dass dies eine Bourgeonâsche Obsession ist, die sich durch alle seine Werke zieht). Die ErzĂ€hlstrategie ist komplex bis kompliziert, mystisches Geraune wechselt mit krassester Gosse, und auch in den Zeichnungen lauert doppelbödiges, symbolisches, ungreifbares. "Das Fest der Narren" erzĂ€hlt von fernen, fremden Zeiten und vielleicht ist es gerade deshalb so ein Meisterwerk, weil es sich prĂ€ziser, einfacher Deutung entzieht. Weil es einen in seiner Hermetik abstöĂt und nicht umschmeichelt. Weil man aber gerade wegen dieser Fremdartigkeit immer wieder zurĂŒckkehrt. (Bernd Kronsbein) Lesetipps:
 Platz 54
Platz 54
Sandman Mystery Theatre
Die Prohibition ist seit vier Jahren vorbei, aber Amerika hat sich verĂ€ndert. Das organisierte Verbrechen ist so mĂ€chtig wie nie zuvor, Jazz erobert die Clubs, Radio-Soaps dröhnen ĂŒber den Ăther, Zeitungen liefern sich bewaffnete Auseinandersetzungen, die Emanzipation feiert erste Erfolge, die Weltausstellung öffnet das Tor in eine verheiĂungsvolle Zukunft, Rassenkonflikte schwelen, Kriegsangst ĂŒberschwemmt das Land, weil ein kleiner Irrer Europa in Brand setzt... Das New York der spĂ€ten 30er ist nie so beeindruckend in Szene gesetzt worden wie in "Sandman Mystery Theatre". In siebzig Heften zwischen 1993 und 99 inszenierten das Autoren-Team Matt Wagner und Steven Seagle gemeinsam mit Zeichner Guy Davis (plus GĂ€sten wie Michael Lark, John Watkiss u.a.) das Portrait einer schillernden Ăra. Sie beschrieben aber auch die komplexeste und glaubwĂŒrdigste Liebesbeziehung zwischen zwei erwachsenen und intelligenten Menschen, die die Comic-Literatur bis heute gesehen hat. Eine Beziehung, die sich im Laufe der Serie entwickelt, verĂ€ndert, tiefer wird, Klippen umschifft und abzuschmieren droht. SMT war zunĂ€chst einmal "nur" ein seltsamer Spin-Off-Titel der "Sandman"-Serie von Neil Gaiman, der sowohl auf die UrsprĂŒnge des "Golden Age Sandmans" zurĂŒckgriff als auch auf die Gaimanâsche Mythologie. SMT war oberflĂ€chlich eine Hommage an die Pulps, aus denen die US-Comics hervorgegangen sind. Der Held stapft in Gas-Maske und Trenchcoat durch die Nacht, um die Bösen zu fangen, und die Heldin kann nicht still auf dem Hintern sitzen und einfach nur auf die RĂŒckkehr ihres Liebsten warten. Wesley Dodds und Dian Belmont hĂ€tten wahrlich ein lustiges Detektiv-PĂ€rchen sein können, eine Art Tracy/Hepburn fĂŒr die Comics, aber genau das sind sie zu keinem Zeitpunkt. SMT ist ernsthaft, prĂ€zise, dĂŒster, nachdenklich. Jenseits vom moralischen Sozialkitsch, der in US-Comics in der Regel serviert wird, interessierten sich die Autoren tatsĂ€chlich fĂŒr ihre Sujets und Figuren. Zu den ĂŒberzeugendsten Strecken gehört zum Beispiel die, in der Dian schwanger wird. Unvorstellbar fĂŒr eine US-Comic-Serie: Sie besucht trotz und wegen aller gesellschaftlicher ZwĂ€nge eine Engelmacherin, sie treibt ab und diese "Tat" liegt wie ein Schatten ĂŒber dem Rest der Serie, ĂŒber allen Beziehungen, die die Reihe bestimmen. SMT war bis zum Schluss die mutigste und unkommerziellste Serie, die sich ein US-GroĂverlag (DC Comics) je gegönnt hat. Das sie ĂŒberhaupt so lange lief ist wohl nur der Begeisterung ihrer Redakteure zu verdanken, die erst den Stecker zogen, als die gesamte US-Comic-Industrie schwer absackte und damit auch die Vertigo-Line. Die Serie bricht ĂŒberhastet ab, im Wunsch der Autoren, wenigstens noch ein adĂ€quates Ende zu finden. Mit dem Eintritt Amerika in den 2. Weltkrieg endet SMT und die Wege der Protagonisten trennen sich. Zumindest fĂŒr eine Weile. (Bernd Kronsbein) Lesetipps:
Platz 55 Der Mann am Fenster
Mit seinen furiosen Farbenspielen in âFeuerâ oder âFlĂŒsterâund anderen hatte Lorenzo Mattotti Ende der Achtziger die Gemeinde der Comicfans in frenetischen Jubel versetzt â ĂŒberschwenglich fĂŒhlten sich einige Kritiker bereits dazu geneigt, die Geschichte der Comics von nun an in eine Zeit vor und eine Zeit nach Mattotti einteilen zu mĂŒssen â da kam der italienische Bildermagier 1992 auf einmal mit einem neuem Band an den Start, der so recht ĂŒberhaupt nicht das war, auf das die Augen der Welt so gespannt gewartet hatten. Im allgemeinen Kopfkratzen und Schulterzucken wurde dieser Band mehr oder weniger ignoriert und fast vergessen, in Erwartung auf des Meisters nĂ€chstes neo-moderne Pastellkreidengewitter. Ein bitteres Unrecht, was diesem Buch geschah, denn wenn man sich dem âMann am Fensterâ ohne Erwartungsdruck und Vorbehalte nĂ€hert, offenbart sich eines der poetischsten und atmosphĂ€rischsten StĂŒcke Comicliteratur, die es je bislang zu sehen gab â so still und intim, wie man es Comics fast gar nicht zugetraut hĂ€tte. Das Szenario von Mattottis Ex-Frau Lilia Ambrosi schildert uns Momentaufnahmen aus dem Alltag eines allein lebenden KĂŒnstlers, der wie der Besucher einer Galerie an den Szenen seines Lebens vorbeigeht und nur in seinen Skulpturen das zelebrieren kann, zu dem er im wirklichen Leben scheinbar unfĂ€hig geworden ist; das Zusammenkommen mit etwas, Teil von etwas sein, mit etwas eine Verbindung eingehen. Er ist nicht einsam, aber allein. Wie ein Blatt im Wind lĂ€Ăt er sich durch seine Stadt treiben, ist ab und an bei Bekannten, aber doch nie mit ihnen vereint, niemals FuĂ fassend, innerlich sich stolz in seinen Monologen ergehend und sein EinzelgĂ€ngertum zelebrierend. Bis er durch einige unvorhergesehene Ereignisse dazu gezwungen wird, seine Haltung zu ĂŒberdenken... Was die Leserschaft mit Sicherheit am meisten irritierte, war die komplett unerwartete Inszenierung, mit der Mattotti diese ruhig dahinflieĂende, bittersĂŒĂe Geschichte anging. Keine expressionistischen Farben diesmal, statt dessen ein Stil, den er vorher in seinen privaten SkizzenbĂŒchern versteckt gehalten hatte: fragile, luftige Federzeichnungen, die dem Abgebildeten fast einen Eindruck von Schwerelosigkeit verleihen. Still, dezent, zurĂŒckhaltend, karg â wie die Geschichte und ihr Held selber. Doch gerade diese Herangehensweise ist die Trumpfkarte des Bandes, denn wenn Ambrosi in ihren tagebuchartigen Fragmenten die kleinen, sonst unbemerkten und gerade deshalb so funkelnden Details des Alltags beschreibt, liegt es am Leser, das WeiĂ des Papiers mit seinen eigenen bekannten SinneseindrĂŒcken zu fĂŒllen und sich von der Schönheit dieser Augenblicke ĂŒberwĂ€ltigen zu lassen. Ein Paradebeispiel dafĂŒr, wie viel man mit ganz wenig erreichen kann, wie durch Reduktion etwas Hochintensives entsteht. (Thomas StrauĂ) Lesetipps:
Platz 56 Little Nemo
Wie real sind TrĂ€ume? Jede Nacht taucht der 6jĂ€hrige Little Nemo ein ins Schlummerland, das Land der TrĂ€ume, in dem König Morpheus herrscht. Es ist eine Welt der Wunder und Visionen, der fliegenden DrachensĂ€nften und Meerjungfrauen, der Lichterorgien und KristallpalĂ€ste, der skurrilen Figuren und Fabelwesen. Hier erlebt Nemo die aberwitzigsten Abenteuer, nur um dann jeden Morgen (d.h. auf dem letzten Panel jeder Seite) unsanft auf den Boden der RealitĂ€t zurĂŒckgerufen zu werden. Als Winsor McCay Little Nemo 1905 als Comic-Seite fĂŒr die Sonntagsausgaben des Herald Tribune entwickelte, war das Medium Comic gerade einmal 10 Jahre jung. Little Nemo stellte damals einen Quantensprung in der Entwicklung der Formen- und Bildsprache der Comics dar. In verspielter Mischung aus barocker Zeichenkunst und Art Deco schuf McCay Comics, die bis zum heutigen Tag verblĂŒffen und inspirieren. Little Nemo ist fĂŒr seinen Schöpfer zugleich auch ein gutes StĂŒck Aufarbeitung der eigenen inneren DĂ€monen gewesen. Das verleiht Little Nemo neben aller ZuckerbĂ€cker-Romantik an der OberflĂ€che eine teilweise sogar beklemmende AuthentizitĂ€t. (Cord Wiljes) Lesetipps:
Leseproben:
Platz 57 You are here
Preisfrage: Was Haben "You are here", "I die at midnight" und "Why I hate Saturn" an Gemeinsamkeiten? Die Antwort: "Sie sind toll, toll und toll" ist schon ganz prima, die Antwort: "Es gibt keine deutschen Ausgaben!" ebenso bitter wie richtig. Ach ja, ich vergaà zu erwÀhnen, daà alle drei von Kyle Baker zu verantworten sind. Kyle Baker ist (zusammen mit Alan Moore, Garth Ennis und Frank Miller) der vielleicht beste lebende ComicerzÀhler und in Deutschland ignoriert man ihn. Soviel zum Zustand des deutschen Comicmarktes. Baker produzierte "You are here" ohne festen Abnehmer und zeigte es dann DC. Gut, das wenigstens die Amerikaner nicht mit Blindheit geschlagen sind. "You are here" ist ein Comic wie ein Trickfilm. Mit Bildern wie auf Filmfolien. Und Computerfarben, die Farbenblinde wieder sehend machen. Traumhaft anzuschauen. "You are here" bietet Bakers Kommentar zum Tarantino-Wahnsinn. Bietet Robert Mitchum in seiner schönsten Comicrolle. Bietet den kuriosesten Frauencharakter seit Oma Duck. Bietet die schönste Sequenz ohne Sprechblasen ever. Bietet SonnenuntergÀnge. Bietet skurrilen Humor und ein liebevolles und dennoch realistisches Stadtbild von New York. Bietet Charaktere, die sich entwickeln. Und ist traumhaft zu lesen. (Ingo Stratmann) Lesetipps:
 Platz 58
Platz 58
Cerebus
Dave Sims Lebenswerk Cerebus ist ein auf 300 Hefte angelegter Entwicklungsroman, der 1977 gestartet wurde und 2004 beendet sein wird. Zu Beginn war Cerebus eine einfache Persiflage auf Barry Windsor SmithÂŽ Conan, in der der Aardvark Cerebus, ein kĂ€mpfendes Schwein, in einer barbarischen Welt allerlei Keilereien besteht. Schon nach wenigen Heften jedoch entwickelte sich Cerebus zur intelligenten Sozialsatire, die mit Querhieben auf Staat, Kirche, Hierarchien und Traditionen geradezu strotzt. Gekonnt gesetzte Pointen, Slapstickeinlagen und Parodien auf bekannte Persönlichkeiten sind urkomisch, nie jedoch Selbstzweck, sondern immer handlungstragende Elemente. Mit zunehmendem Fortschreiten der Serie begrenzt Sim den Fokus immer mehr auf einige wenige handelnde Figuren und deren Interaktionen. In symbolisch ĂŒberzeichneten Traum- und Fantasiesequenzen wird der Zauber und Alptraum des normalen Alltags und der menschlichen Interaktion enthĂŒllt. Wenn Sim hier teilweise selbstreferenziell bis zur Unlesbarkeit wird und seinen misogynen Marotten frönt, dann ist das konsequenter Teil seines SelbstverstĂ€ndnisses: Er sieht sich als KĂŒnstler nur seinem Werk verpflichtet. Sims glasklare s/w-Zeichnungen, in spĂ€teren Heften unterstĂŒtzt von Gerhard, und ein auĂergewöhnliches Lettering machen Cerebus darĂŒber hinaus auch zu einem optisch Erlebnis. AuĂerdem bietet Cerebus das wohl auĂergewöhnlichste Lettering, das an vielen Stellen zum integralen Bestandteil der Handlung wird. Cerebus ist ein Experiment, das schon allein ob seiner GröĂe Bewunderung verdient. Wenn die geplanten 6000 Seiten Cerebus komplett sein werden, dann liegt ein Gesamtkunstwerk vor, das in seiner Ambitioniertheit wie in seiner Konsequenz einzigartig ist. (Cord Wiljes) Lesetipps:
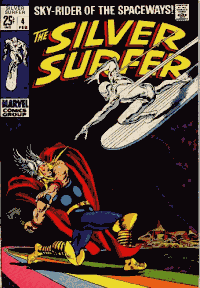 Platz 59
Platz 59
Silver Surfer
Mehr Pathos war nie: Er hat sich fĂŒr seinen Heimatplaneten geopfert, seiner groĂen Liebe entsagt, dem Weltenverschlinger Galactus als kosmischer Herold gedient, die Erde vor seinem Herrn gerettet, und wurde von diesem dafĂŒr verbannt. Der Dank der Menschen: Hass und Verfolgung. "Doch der Mensch, der die Herrschaft ĂŒber diese Welt errungen hat...er kennt den Frieden nicht!! - Denn er ist ein Gefangener im Netz seiner namenlosen Ăngste." Er ist der Silver Surfer: ein kĂ€mpfendes Blumenkind, ein schwerbewaffneter Pazifist, ein surfender Poet. Und er ist vor allem eins: Ultracool! Wenn er mit seinem Surfbrett unterm Arm am Hofe der unsterblichen Asen in Walhall erscheint, gegen den fliegenden HollĂ€nder, auĂerirdische Echsen oder den leibhaftigen Mephisto antritt - dann hat das Stil. John Buscema, auf dem Höhepunkt seines Könnens, zeichnet den Surfer mit unĂŒbertroffen Ă€therischer Eleganz. Selbst Moebius kann ihm mit seinem Remake 20 Jahre spĂ€ter nicht das Wasser reichen. Stan Lee, dessen erklĂ€rte Lieblingsfigur der Silver Surfer war, verlieh ihm messianische ZĂŒge und dichtete seinem Helden Geschichten und Verzweiflungsmonologe auf den Leib, die einen Hamlet blass aussehen lassen. Im Grunde muss man sagen: das ist Kitsch. Aber grandios, herzzerreiĂend und erhebend: Galaktisch guter Kitsch. (Cord Wiljes) Lesetipps:
Platz 60 Nick Fury
Er war das GegenstĂŒck zu Neil Adams, revolutionierte er das Medium doch auf Ă€hnlich drastische Weise. Doch wo Adams an Michelangelo geschulte Anatomie und mathematisch ausgetĂŒftelte Perspektiven zeigte, waren Jim Sterankos Stories nur am coolen Aussehen interessiert (dies macht ihn zu einem frĂŒhen Vorfahren der Image-Boys). Und obwohl Sterankos aktive Comic-Zeichner-Zeit gerade einmal 29 Monate umfasst, wurde er zu einem Idol, einem Star und sein frĂŒher RĂŒckzug machte ihn nur noch geheimnisvoller. Als er die ComicbĂŒhne betrat hatte der Freund von Orson Welles (beide waren im New Yorker Zaubererzirkel aktiv) bereits eine Zirkuskarriere als EntfesselungskĂŒnstler (er war das Vorbild fĂŒr Mr. Miracle aus Kirbys Fourth World-Serie), Rockmusiker, Werbegrafiker und Privatdetektiv hinter sich. ZunĂ€chst nur als Assistent von Jack Kirby stieg er Ende 1966 mit Heft 151 in Nick Fury, Agent Of S.H.I.E.L.D. ein, der sich damals das Heft Strange Tales mit dem Magier Dr. Strange teilen musste. Nach wenigen Monaten ĂŒbernahm Steranko die Serie komplett und machte aus dem braven James Bond-Epigonen die visuell aufregendste Serie seiner Zeit. Jede Seite sprang den Betrachter an und kreischte ihm ins Gesicht: "This is Pop", Kollagen aus Zeichnungen und Photos, psychedelische Farben, Stroboskoplichteffekte und kontrastreiche KomplementĂ€rfarbgebung waren Sterankos Mittel. Eine filmisch aufgebaute Seite, die vollkommen ohne Text auskam, machte auch dem dĂŒmmsten Leser klar, daĂ Nick gerade Sex hatte. Nach anderthalb Jahren war Nick Fury so populĂ€r, daĂ er sein eigenes Heft bekam. Doch damit begannen Sterankos Schwierigkeiten: Die Verdoppelung seines SeitenausstoĂes gelang ihm nicht, schon die Nummer 4 musste von einem Gastzeichner gestaltet werden, nach Heft 5, zwei X-Men und drei Captain America-Heften stieg Steranko aus. Ohnehin war er eher an grafischen Experimenten, denn am GeschichtenerzĂ€hlen interessiert und so war es nur folgerichtig, dass er Anfang der siebziger das Marvel-Fanzine Friends Of OlÂŽ Marvel redaktionell ĂŒbernahm und gleichzeitig die auf sieben BĂ€nde angelegte Steranko History Of Comics in Angriff nahm, all dies nur eine VorĂŒbungen fĂŒr seine eigene Zeitschrift Comixscene, spĂ€ter Mediascene, dann Prevue. Er arbeitet an Filmen wie Outland, JĂ€ger des verlorenen Schatzes und Coppolas Dracula mit und lieferte alle paar Jahre eine interessante Comic-FingerĂŒbung ab. (Lutz Göllner) Lesetipps:
Leseproben:
 Platz 61
Platz 61
Micky Maus
Deutschland ist kein Micky Maus-Land. Es ist ein Donald Duck-Land. Die Geschmacksbildung in Sachen Comics hat hier weitgehend ein Herr Barks geleistet. Unter den Folgen leiden die Disney-Comics heute, denn die Ignoranz gegenĂŒber anderen Disney-Zeichnern ist groĂ. Die Fanszene verehrt"Die Besten Geschichten mit Donald Duck" und "Die Tollsten Geschichten mit Donald Duck", huldigt der "Barks Library", ignoriert die "Micky Maus" seit dem Ende der Barks-Ăra und hĂ€lt die "Lustigen TaschenbĂŒcher" fĂŒr beliebige Strand- oder BadewannenlektĂŒre. Welch ein fataler Irrtum! Die "Lustigen TaschenbĂŒcher" sind hauptsĂ€chlich mit Stories aus dem italienischen "Topolino" bestĂŒckt. Die italienischen Autoren und Zeichner sind schon seit den siebziger Jahren fĂŒr die schlechtesten Disneystories verantwortlich, allerdings auch, und damit sind wir endlich beim Thema, fĂŒr die besten. Carpi, Cavanazzo und Scarpa sind die unbesungenen Helden der Disneycomics. Romano Scarpa, der von 1953 an fĂŒr Disney arbeitende Venezianer, ist sicherlich der beste MM-Zeichner seit Gottfredson. Er bevorzugt MM, zeichnet aber nicht weniger DD. Sein Stil ist am erklĂ€rten Vorbild geschult und damit anfangs mehr retro als der anderer Zeichner. Scarpas Charaktere zeichnet eine nie dagewesene Lebendigkeit aus, eine Beweglichkeit, die es mit sich bringt, daĂ die GesichtszĂŒge der Figuren hĂ€ufig entgleisen. Bei Scarpa wird viel grimassiert und noch mehr geschwitzt. Die Anspannung der Figuren ist immens. Mediziner fordern schon lange den Drogentest fĂŒr Scarpas Disney-Familie. Seine Plots sind entsprechend wild und originell und in seiner groĂen Zeit teilt er Gottfredsons und BarksÂŽ Faible fĂŒr exotische Sujets. Leute, ignoriert Scarpa nicht, lest die "Lustigen TaschenbĂŒcher" (Ingo Stratmann) Lesetipps:
Leseproben:
 Platz 62
Platz 62
300
We march. Mit keinem Wort zuviel, dafĂŒr mit um so mehr Kirby-wĂŒrdiger Felsigkeit beginnt es, und nach vier berauschenden Doppelseiten mit nichts als Marschieren, monumentaler Ădnis und schlierigem Aquarellhimmel die aus Stein gehauene historische Verortung: wir befinden uns im Jahre 480 v.Chr., zusammen mit dreihundert spartanischen Kriegern, die unter ihrem König Leonidas das freie Griechenland gegen die einfallenden Perser und deren Gott-König Xerxes zu verteidigen suchen. Das Ende ist Geschichte: ein Hagel persischer Pfeile, totale Agonie, Heldentod. Keine noch so klotzigen Phrasen können wiedergeben, wie Miller, assistiert von den wunderschön erdigen Farben seiner LebensgefĂ€hrtin Lynn Varley, als Hardboiled-Homer diese antike Tragödie zu einem beispiellosen Heroic-Bloodshed-Epos im Breitwandformat ausarbeitet. Vom Ronin-, Dark Knight- und Sin City-Miller ist offensichtlich nur das jeweils beste geblieben, um zusammengepackt die Millersche Kunst auf ein neues Level, das nĂ€chste Plateau zu heben. So klar, dramatisch, effektiv und "spartanisch" war er nie; zwischen sparsamst gesetzten, gleichzeitig wie ĂŒberlieferter Leonidas-O-Ton und originĂ€r millerisch klingenden Texten, bluttriefenden Kolossalschlachten, schwĂ€rzesten Sarkasmen und der von Frisuren bis Sandalen alle Details umfassenden AuthentizitĂ€t bleibt kein Moment zum Atemholen. Zahlreiche Doppelseiten sind GemĂ€lde fĂŒr sich, ohne den Rest dominant ausstechen zu wollen. So ĂŒberzeugend verschwenderisch und dazu ökonomisch wurden Comicseiten selten in Paneleinheiten unterteilt. Da fĂ€llt es kaum ins Gewicht, daĂ Miller keine Elefanten zeichnen kann - die rutschen denn auch sofort auf den angehĂ€uften persischen Leichenbergen aus und stĂŒrzen die Berge hinab. Sparta also: dort sind die wahren Superhelden zu finden, hĂ€rter noch als Marv und edler sowieso. Frank Millers Arbeiten mögen auf den ersten Blick immer ein wenig Skepsis wecken, zumal ein solch ĂŒbertriebener Stoff wie der der 300: man kann es so oft lesen wie kaum einen anderen zeitgenössischen Comicproduzenten, und es gewinnt immer mehr. Und seine Comics sind sicher nicht der Ort, an dem man den ergriffenen Schauder angesichts des ultimativen Kriegscomics politisch in Frage stellen sollte. (Sven-Eric Wehmeyer) Lesetipps:
Leseproben:
 Platz 63
Platz 63
Grendel
Grendel ist ein Konzept. Am Anfang stand eine einfache Geschichte, die ĂŒber die Jahre immer komplexer wurde und an der immer mehr Menschen Teil hatten. Matt Wagner erfand die Figur in den frĂŒhen 80ern. Grendel, das war Hunter Rose, ein Wunderkind, das aus Langeweile erst Schriftsteller, dann Fechter und schlieĂlich Boss einer gigantischen Gangster-Organisation wurde. Die Geschichte des Hunter Rose wurde schlieĂlich so umfangreich, dass Wagner einen ersten Versuch sie zu ErzĂ€hlen, abbrach und Jahre spĂ€ter einen weiteren Anlauf unternahm, der ihrer zunehmenden KomplexitĂ€t auch gerecht wurde. "Devil by the Deed" hieĂ die Graphic Novel, die das Leben von Rose in verschachtelten, ornamentalen Illustrationen mit straffen Prosa-Passagen auf den Punkt brachte. In der Form eher eine Legende als alles andere. Mehr aus der (Zeit-) Not heraus entschied sich Wagner, die Fortsetzung der Geschichte nicht selbst zu zeichnen, sondern dies anderen KĂŒnstlern zu ĂŒberlassen. Und er entschied, dass keine Grendel-Geschichte der anderen erzĂ€hlerisch Ă€hneln sollte. Grendel also als eine Art Experiment in Progress. Bei der Wahl der Zeichner ging Wagner ebenfalls nicht den einfachen Weg. Keine groĂen Namen, keine sicheren Sachen. Stattdessen junge, unbekannte Talente mit eigenem Strich, eigenem Stil. Die Pander-BrĂŒder, Bernie Mireault, John K. Snyder/Ray Geldof, Tim Sale und Pat McEown; diese Namen haben zwar heute alle einen guten Klang, aber in den Rang eines Stars ist höchstens Tim Sale mit seinen eleganten Batman-Halloween-Stories gelangt. Anfangs ĂŒbertrug Wagner die Maske Grendels in einer Art Erbfolge, dann machte er einen radikalen Schnitt und verlegte die Geschichte in die ferne Zukunft. In eine Zukunft, in der Grendel fester Bestandteil der Kultur geworden ist, in der Grendel-Clane sich befehden und ein Clan-FĂŒhrer sogar zum Weltherrscher wird. Getreu seinem Motto, sich nicht zu wiederholen, wechselte Wagner die Themen bestĂ€ndig. Von reiner Action zu hochkomplexen, politischen Epen, alles war möglich. In den 90ern ĂŒberlieĂ Wagner dann auch anderen Autoren das Feld â und jeder hatte eine Chance, egal wie bekannt oder unbekannt er war. Er musste nur Wagner von seiner Idee ĂŒberzeugen. Wagner ist seiner Figur bis heute treu geblieben. Erst jĂŒngst erschienen zwei bemerkenswerte Projekt: "Grendel: Black, White & Red", in dem zahlreiche Hunter-Rose-Vignetten von einem Haufen groĂartiger Zeichner illustriert wurde. Und "Grendel: Past Prime", ein Roman von Crime-Shooting-Star Greg Rucka. Die Grendel-Saga mutiert also weiter. Das Experiment ist noch nicht abgeschlossen. (Bernd Kronsbein)
 Platz 64
Platz 64
Mad 1-28
MAD - der Wahnsinn hat Methode: 48 Jahre gibt es das Magazin jetzt schon, nahezu ein halbes Jahrhundert Humor und Ironie vom Feinsten, dick aufgetragen und ohne jeden Respekt vor Staat, AutoritĂ€ten und Traditionen. Wer kennt sie nicht, die bunte Menagerie von Alfred E. Neumann, Spion & Spion, Dave Bergs Lighter Side, Sergio AragonesÂŽ Mini-Cartoons und dem, was "the usual gang of idiots" sonst so Monat fĂŒr Monat unter die Kiddies (und deren ausgewachsene Version) hauen. Seinen Ursprung hat Mad 1952 im amerikanischen Verlagshaus EC, wo es als Sprössling des Verlegers William Gaines und des Herausgebers Hervey Kurtzman das Licht der McCarthy-Ăra erblickte. Kurtzman, selbst ein begnadeter Zeichner, hatte als Herausgeber der auĂergewöhnlichen EC-Kriegscomics von sich reden gemacht. Ăber Jahre hinweg hatte er auĂerdem den einseitigen Humor-Cartoons "Hey Look!" (Sammelband bei Fantagraphics) geschaffen, der quasi Vorstudien zu seiner MAD-Arbeit bilden sollte. Vielleicht war die Zeit einfach reif fĂŒr ein Humor-Magazin wie Mad, sicher ist aber: Kurtzman und Gaines waren die ersten, die mit einem radikalen Satiremagazin an den Markt gingen. Der Erfolg war sensationell. Unter Kutzmans Ăgide entstanden mit den hervorragenden Zeichner des Verlages (Jack Davis, Wally Wood u.a.) die ersten 28 Hefte, die bis Heft 24 noch in Comicform, danach als Magazin, bekannte Figuren aus den Medien auf die Schippe nahmen. Sie wurden damit zum Vorreiter eine humoristischen Tradition, die bis heute in alle Bereiche der amerikanischen Medien weiterwirkt. Dabei sind die frĂŒhen Geschichten, wie die Superman-Parodie "Superduperman" aus Heft 4, auch heute noch zum BrĂŒllen komisch und genauso aktuell wie damals. Und soll man den Heerscharen PĂ€dagogen, Politikern und anderen BedenkentrĂ€gern entgegenenhalten, die seit nun fast fĂŒnf Jahrzehnten unfĂ€hig sind, hinter den Brachialhumor Mad`scher PrĂ€gung zu sehen? - "What me worry!" (Cord Wiljes) Lesetipps:
 Platz 65
Platz 65
Understanding Comics
Scott McCloud hat ein Buch geschrieben. Ein Buch ĂŒber Comics. Ăber die Sprache der Comics, die Grammatik, wie Zeit im Comicstrip funktioniert, wie GedankengĂ€nge miteinander verknĂŒpft werden, wie in einem starren Medium Bewegung dargestellt werden kann. Das Ganze in Form eines Comics. âBist Du fĂŒr so was nicht noch ein biĂchen zu jung?â, fragt sein Kollege Matt Feazell mitleidig im Vorwort. Angeregt durch Will Eisners theoretische BĂ€nde einerseits und die UniversitĂ€ts-Seminare von Art Spiegelman andererseits hat McCloud ein seltenes KunststĂŒck vollbracht: âComics richtig lesenâ ist ein ebenso unterhaltsames wie lehrreiches Buch geworden, ein intelligentes Standardwerk, das nun wirklich in jede Bibliothek gehört. McCloud taucht in die Geschichte der BilderzĂ€hlungen ein und liefert einen kompletten kommunikationstheoretische Basisbau. Selten sind dem Leser FachausdrĂŒcke der Semiotik besser erklĂ€rt worden. âDie Grenzen des Mediumsâ, so McCloud optimistisch, âsind noch lange nicht erreicht.â Den Beweis fĂŒr diese These tritt er mit seinem eigenen Buch an. P.S.: Und wer es nicht ganz so schwerwiegend mag: Sowohl McClouds eigene Serie âZotâ, als auch seine Auftragsarbeiten fĂŒr die âSuperman Adventuresâ (auf deutsch teilweise bei Dino) liefern einen beeindruckenden Beweis fĂŒr seine Thesen. (Lutz Göllner) Lesetipps:
Platz 66 Die hermetische Garage des Jerry Cornelius (u.a.)
1963 in Frankreich: Paris kommt langsam ins Erneuerungsfieber. Beatniks und Studenten spielen mit neuen Wegen, die Gesellschaft umzukrempeln. Ein junger Mann namens Jean Giraud, der mit seiner Westernserie "Blueberry" bereits eine treue AnhĂ€ngergemeinde um sich geschart hat, lĂ€Ăt sich in den Strom der UmwĂ€lzungen hineinziehen, liest Castaneda und Moorcock, schluckt Pilze, hört Free Jazz und Psychedelia und beginnt mit spielerischer Experimentierfreude und jeder Menge guter Laune einen Urknall auf Papier zu bannen, dessen Nachbeben bis heute in allem mitschwingen, das versucht, uns eine "Welt von morgen" zu prĂ€sentieren. Was fĂŒr einen gewaltigen Impact das Werk dieser - hier kann man es ohne weiteres behaupten - lebenden Legende auf alles hatte, was auch nur im entferntesten mit Science Fiction zu tun hat, darĂŒber werden sich kommende Generationen von Kunsthistorikern die Köpfe heiĂreden können. Fest steht, daĂ Moebius mit seinen Stories der frĂŒhen 70er einen neuen Standard fĂŒr fantastische Bildwelten erschuf, der die Comicwelt der Roboter und Riesenraumschiffe vom Pulp der amerikanischen 50er emanzipierte und mit einem Schlag erwachsen werden lieĂ; bereits in Geschichten wie "The long tomorrow" wurden stilistische Ideen gezĂŒndet, von der sich ganze Armeen von Nachahmern inspirieren liessen, und die sich dann in den 80ern in Kultfilmen wie "Alien" und "Blade Runner" sowie in den 90ern im gesamten Ă€sthetischen Arsenal der Cyberpunk-Schiene wiederfanden. Futuristische Design-Attacken wie Luc Bessons "Das fĂŒnfte Element" z.B. wĂ€ren ohne Moebius ĂŒberhaupt nicht möglich gewesen. Was sein Werk in der FrĂŒhphase so charmant machte, war die fast unschuldige Verspieltheit, mit der er bei der Inszenierung seiner Utopien zur Sache ging. In seiner Serie "Die hermetische Garage des Jerry Cornelius" fĂŒhrte er einen langen Durchmarsch durch zig verschiedene Zeichenstile und lieĂ die Handlung ohne vorherige Planung - Ă€hnlich wie beim automatischen Schreiben der Surrealisten - von Folge zu Folge in völlig unvorhersehbare Richtungen kippen. Ăberall in seinen Arbeiten schwang stets ein sonniges Augenzwinkern mit, ein freundliches sich-selber-nicht-allzu-ernst-nehmen, selbst wenn er sich - und das tat er hĂ€ufig - mit hippiesker Esotherik beschĂ€ftigte. Als er in den Achtzigern zusammen mit Alexandro Jodorowsky den Mega-Renner der "Inkal"-Geschichten in die Welt setzte, ging dieser esoterische Gaul mit ihm durch. Seine unverwechselbare Art der Schraffur machte Platz fĂŒr einen neuen, glasklaren Strich, und die Inhalte entschwebten langsam aber sicher in Richtung New-Age-Ăther. Aber der irrsinnige Erfolg dieser neuen Marschrichtung bewies, daĂ fĂŒr das Gros der Comicfans genau hier der Moebius geboren wurde, den sie bis heute schĂ€tzen, lieben und vergöttern. (Thomas StrauĂ) Lesetipps:
 Platz 67
Platz 67
Prinz Eisenherz
Prinz Eisenherz - ist das nicht der Kerl mit dem Pottschnitt? Aus dem grottigen Hollywood-Film mit Robert Wagner? Und die Prinz Eisenherz-Comics - werden die nicht von der Sigurd-Klientel gelesen, von Rentnern mit NostalgiegefĂŒhlen? Auf jeden Fall alte Kamellen, die nicht mal richtige Sprechblasen haben. Total uncool! Soweit die Legende, und jetzt zur RealitĂ€t: Mehr Metzeleien als in Spawn, Punisher oder Lobo. GröĂere Helden als in JLA, Fantastic Four oder Superman. Schönere Frauen als in Witchblade, Fathom oder Darkchylde. Rasanter als Preacher, lustiger als die Simpsons, besser gezeichnet als Kingdom Come: Prinz Eisenherz, Thronfolger von Thule, Ritter der Tafelrunde, Abenteurer, Ehemann, Vater. Einer, der das Abenteuer sucht, dem die Gunst schöner Frauen zufĂ€llt, der Familie und Heimat beschĂŒtzt, der Freunde gewinnt und Ruhm erntet. Und das ganze 34 Jahre lang, von 1937 bis 1971 von Hal Foster erzĂ€hlt und gezeichnet. Foster, der 1931 nach fĂŒnf Jahren als Zeichner der Tarzan-Sonntagsseiten seine eigene Serie gestalten wollte, richtete Prinz Eisenherz (im Original: Prince Valiant, engl. valiant = tapfer) von Anfang an konsequent an seinen eigenen Interessen aus: Mit viel Akribie recherchierte er die geschichtlichen ZusammenhĂ€nge, nutzte jede Gelegenheit, seine Liebe zur Natur in opulente Landschaftsgrafiken umzusetzen, und lieĂ bei allem Ernst der Handlung immer auch humorvolle Momente aufblitzen. Prinz Eisenherz war, wie Foster gestand, eine idealisierte Form seiner selbst; EisenherzÂŽ Frau, der wunderschönen Aleta, Königin der Nebelinseln, diente Fosters Frau Helen als Vorbild. DarĂŒber hinaus lieĂ Foster Prinz Eisenherz altern, wenn auch langsamer als in der RealitĂ€t: Vom jugendlichen HeiĂsporn ĂŒber den erfahrenen KĂ€mpfer bis zum weisen Strategen und treusorgenden Familienvater. Dass Foster neben seiner ĂŒberragenden grafische Begabung auch ein groĂer GeschichtenerzĂ€hler war, davon legt Prinz Eisenherz von der ersten bis zur letzten Seite Zeugnis ab. Weil Hal Foster sich selbst eher als Grafiker denn als Comic-Zeichner sah, verzichtete er bei Prinz Eisenherz auf Sprechblasen und arbeitete statt dessen mit kurzen Prosatexten unter den Bildern. Die brillanten Farben und der ĂŒberformatige Zeitungsdruck lassen sich leider in Reproduktionen nur sehr unbefriedigend wiedergeben. Eine sehr schöne (leider nicht komplette und sehr kostspielige) Ausgabe mit Photoreproduktionen der Original-Zeitungsseiten ist bei Splitter erschienen, die Carlsen BĂ€nde mit neuer Colorierung und viel zu kleinem Alben-Format lassen den Glanz des Originals nur erahnen. Mit insgesamt 1788 Seiten Prinz Eisenherz hinterlieĂ Hal Foster eines der gröĂten zusammenhĂ€ngenden Comic-Kunstwerke, das heute noch genauso frisch und lesbar ist wie vor 50 Jahren. P.S.: Der Haarschnitt ist kein fashion statement, sondern dient zum Auspolstern des Helmes. In einer Episode wird Eisenherz gar gezwungen, sich seines Kopfputzes komplett zu entledigen. (Cord Wiljes) Lesetipps:
 Platz 68
Platz 68
Mickey Mouse
Der Vater der Maus heiĂt Walt Disney. Schon in frĂŒhen Jahren gab er sein Kind zur Adoption frei. GroĂgezogen hat es Floyd Gottfredson. Eine glĂŒckliche Entscheidung. Von 1930 bis 1975 brachte Gottfredson Mickey (so hieĂ das Kind) alles bei, was der fĂŒr ein Leben auf Papier alles wissen muĂte. Er lieĂ seine Maus noch Maus sein. Zumindest mehr Maus als Mensch. Sophistication und Langeweile gab es unter Papa Floyd nicht. Die goldenen Regeln: Sei rechtschaffen, aber laĂ dich nicht zum verlĂ€ngerten Arm des Gesetzes machen. VerlaĂ die triste Vorstadtwelt. Tummel dich im Dschungel, im Wilden Westen oder meinetwegen auf einer Insel in den Wolken. Junge, erleb was! Der Junge tat, wie ihm geheiĂen und wir beobachteten ihn dabei. Wir lernten erstaunliche WeggefĂ€hrten kennen. Kater Karlo, der Gewaltprotz mit der Beinprothese; das Phantom, ein entzĂŒckendes Etwas an Charakter, das Micky immer auf irgendeine Mordmaschine zwĂ€ngte und sich dann entschuldigte, weil es doch zu zartbesaitet sei, um dem Ableben des mickrigen Gegners beizuwohnen; Gamma, das Wesen aus dem 25. Jahrhundert, das verdammt viele seltsame Eigenschaften (unter anderem haĂte er Geld) und einen noch seltsameren Hund hatte. Nachdem Gottfredson sich nicht mehr um Mickey kĂŒmmern konnte, fiel der in ein tiefes Loch. Er verlieĂ kaum noch die eigenen vier WĂ€nde, trug nur noch hĂ€Ăliche Klamotten und verkaufte seine Seele der Entenhausener Polizei. Er schien sich selbst zu hassen. Es dauerte Jahrzehnte, bis Mickey die Konsequenzen zog und ausstieg, sich einfach davonmachte und Amerika ohne Mickey Mouse-Comics zurĂŒcklieĂ. Er war es seinem Vater schuldig. Interviewer: Herr Barks, wer hat sie am meisten beeinfluĂt? Antwort: Floyd Gottfredson. Und der gab das Kompliment umgehend zurĂŒck. Die Jungens wollten nett sein. Giganten unter sich. (Ingo Stratmann) Lesetipps:
Platz 69 Short Stories
Neben seiner markanten, ultracleanen Neo-Retro-Fifties-Grafik, die ihn auf Postern und Plattencovern bei der Alternative-Rock-Gemeinde beliebt machte (das SubPop Maskottchen Punky stammt aus seiner Feder) stehen die Geschichten von Daniel Clowes vor allem fĂŒr eine skalpellscharfe Beobachtungsgabe, mit der er das Gehirn seiner Protagonisten durchleuchtet und uns einen faszinierenden Blick unter eine zunĂ€chst unscheinbare OberflĂ€che ermöglicht. Innere Monologe, die so ĂŒberzeugend daherkommen, daĂ man stĂ€ndig das GefĂŒhl hat, es hier mit Autobiografischem zu tun zu haben, obwohl das meist nicht stimmt. Was 1985 mit "Lloyd Llewellyn" als Remnisenz an 50er Trashkultur begann, wurde mit Beginn der 90er in seiner Heftreihe "Eightball" zu einem höchst eigenen Universum, dessen Stories stĂ€ndig auf der Grenzlinie zwischen AlltĂ€glichkeit und Surrealismus tĂ€nzeln - und anschlieĂend in eben jenen umkippen. Oft und gerne entsteigt Clowes auch völlig in surreale SphĂ€ren und fördert dabei nicht mehr von dieser Welt stammende paranoide Horrorthriller zutage wie "Like a velvet glove cast in iron" (deutsch "Wie ein samtener Handschuh in eisernen Fesseln" bei Reprodukt), der immer wieder mit "Twin Peaks" verglichen wurde, in seiner Krank- und Krassheit aber noch Meilen weiter geht als Lynchs Psycho-Soap. Zur Zeit sitzt Clowes zusammen mit Terry Zwigoff, dem Regisseur des "Crumb"-Films an der Verfilmung seines 98er Meisterwerks "Ghost World", mit "American Beauty" Thora Birch als Enid und Scarlett Johansson als Rebecca. Clowes hat extrem klare Vorstellungen von dem, was er als "gutes Entertainment" betrachtet und hat Hollywood schon des öftren die TĂŒr vor der Nase zugeschlagen - diesmal aber sitzt er selbst am Hebel. So wird er also hoffentlich demnĂ€chst dem Kinopublikum vorfĂŒhren, was das Comicpublikum schon lĂ€ngst von ihm gewohnt ist: ambitionierte, hochintelligente Charakterstudien mit morbider Note - oder umÂŽs einfacher zu sagen: verdammt gutes Storytelling. (Thomas StrauĂ) Lesetipps:
 Platz 70
Platz 70
Die Abenteuer von Rosalie
Wer kennt heute noch Calvo? Die französisch-belgische Comic-Geschichte beginnt fĂŒr uns meist bei HergĂ©. Und dann kommt noch eine ganze Weile gar nichts. Dabei hatte Edmond-François Calvo (1892-1957) erst relativ spĂ€t, doch immerhin schon 1938 mit dem professionellen Zeichnen begonnen und bald einen ausgeprĂ€gten, unverwechselbaren Stil entwickelt. Obwohl nun um ihn herum gerade die neueren Comics richtig in Mode kamen, beharrte er aber zunĂ€chst eigenwilligerweise noch auf der Tradition der Bildergeschichte, die gemĂŒtlich von Bild zu Bild voranschreitet, bei ihm allerdings in einem waghalsig verschachtelten Seitenaufbau. Und dazu kommen expressiv verdrehte, maniriert verzerrte Dekors wie Figuren und eine unglaubliche Detaildichte, die von sich aus jeden hektischen LesefluĂ abbremst. Angefangen hatte er mit durchaus realistischen Geschichten, u.a. einer Adaption der "Robin Hood"-Verfilmung mit Errol Flynn. Aber schon bald wandte er sich vorwiegend antropomorphen Tierfiguren zu, wie etwa dem Hasen "Patamousse" (1943). Hier lĂ€Ăt sich sehr gut erkennen, warum ihn Walt Disney schon bald anheuern wollte. Calvo aber blieb lieber bei seinen eigenen Bildergeschichten (und dem Vernehmen nach der französischen KĂŒche), und es entstand, noch in der Endphase der Besatzungszeit, die unglaubliche Tierfabel "Die Bestie ist tot", eine von seinem damaligen Verleger Victor Dancette verfaĂte, patriotisch ĂŒberhöhte Propaganda-Geschichte, die allerdings vor dem Hintergrund heute von Art Spiegelmans "Maus" neue Beachtung verdiente. Hier sind die Franzosen friedliebende Hasen, die Deutschen mordlĂŒsterne Wölfe (und eine wunderbare Karikatur zeigt den verschlagenen Leitwolf - Hitler natĂŒrlich -, wie er den Mond anheult). Unglaublich daran ist aber vor allem das ĂŒberbordende Artwork Calvos, das sich bis hin zu triumphalen Doppelseiten mit ĂŒppigen Details steigert, voller Spannung wie Bildwitz. Sein grandioses MeisterstĂŒck in diesem Stil wurden aber ein Jahr spĂ€ter "Die Abenteuer von Rosalie", einem kleinen, antropomorphen (!) Automobil. Wieder spielt hier zwar der Krieg eine einschneidende Rolle (diesmal der von 1914-18), aber Calvos Ehrgeiz zielte nun vor allem darauf ab, auch das noch so kleinste Ding zu beleben. So wimmelt es in Rosalies Geschichte nur so von Autozubehör, Werkzeugen und Kleinteilen, die allesamt mit Gesicht, HĂ€nden und FĂŒĂen ausgestattet sind und zum SchluĂ ein ausgelassenes Fest feiern. Ein groĂartiges, originelles und höchst amĂŒsantes PhantasiestĂŒck. An Sprechblasen hat sich Calvo in seiner SpĂ€tphase ĂŒbrigens doch noch gewöhnt. Von seinen umfĂ€nglichen Begleittexten wich er trotzdem nicht ab, und erst recht nicht von seinem unvergleichlichen, verschlungenen Stil. Aber zurĂŒck zu der Frage, wer kennt heute noch Calvo? Da war 1940 ein 13jĂ€hriger Junge, der jeden Samstag stundenlang fasziniert Calvo beim Zeichnen ĂŒber die Schulter sah. SchlieĂlich zeigte er ihm schĂŒchtern auch seine eigenen ersten Versuche. Und Calvo munterte ihn freundlich auf weiterzumachen. Der Junge hieĂ Albert Uderzo und bezeichnet Calvos Arbeiten noch heute als eine seiner prĂ€genden Anregungen. Vielleicht hat er damals den SpaĂ an der DetailfĂŒlle entdeckt? Wenn das so ist, dann kennt Calvo heute eigentlich jeder - ohne es zu wissen. (Martin Budde)
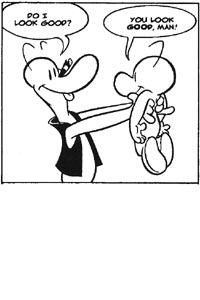 Platz 71
Platz 71
Bone
Als Jeff Smith 1991 auf der Comic-Szene auftauchte galt er als unverfĂ€nglich. Die Geschichte der knollennasigen Cousins Bone, die sich in einem zauberhaften Land verlaufen haben, kam als relativ harmlose Mischung aus Walt Disneys funny animal-Comics und dem Zeichenstil von Walt Kelly - allerdings ohne dessen politisch-satirische TiefenschĂ€rfe - daher: niedlich, knuddelig und vollkommen gutartig. Die unglaublich schlechte deutsche Ăbersetzung der ersten BĂ€nde (Carlsen) verstĂ€rkte diese Impression. Mit der Zeit Ă€nderte sich dieser Eindruck jedoch. Bone wurde immer abgrĂŒndiger, dĂŒsterer und sogar auswegloser. Trotzdem kann die ErzĂ€hlung von allen Altersschichten gelesen werden: Kinder amĂŒsieren sich ĂŒber den schĂŒchternen Fone, dem dĂŒmmlichen Smiley und dem gierigen Phoney, Erwachsene können die gekonnte VerknĂŒpfung komplizierter PlotfĂ€den bewundern. Smiths gesamte ErzĂ€hlung steuert auf einen gewaltigen Konflikt zwischen den KrĂ€ften des Guten und des Bösen hin, wobei Smith so clever ist und bis heute nicht offenbart hat, wer alles auf der Seite der Bösen steht. Und selbst die zweijĂ€hrige Pause, die Smith gerade eingelegt hat, um ungestört am Bone-Film zu arbeiten, wird listig mit den Arbeiten anderer Könner, wie Charles Vess, gefĂŒllt. Bisheriger Lohn der Arbeit: Sieben Eisner und vier Harvey-Awards. (Lutz Göllner) Lesetipps:
 Platz 72
Platz 72
Eddy Current
So kannâs gehen, wenn man sich zu sehr mit einem Superhelden aus einem obskuren Comic identifiziert: Endstation KlapsmĂŒhle. Jedenfalls, wenn man an den falschen Comic gerĂ€t; und der âErstaunliche Broccoliâ war fĂŒr Eddy Current schon eine verdammt unglĂŒckliche Wahl, um sein schwer neurotisches, Ă€uĂerst labiles Ego zu restabilisieren. Noch fataler allerdings wirkte sich die Kleinanzeige darin aus, die mit dem Versprechen: âWerden Sie endlich erwachsen! Werden Sie ein richtiger Mann!â - durch einen âDynamic-Fusionâ-Anzug (Batterien nicht inbegriffen). NatĂŒrlich muĂte Eddy ihn haben. Und natĂŒrlich muĂte er wieder mal ĂŒbertreiben. Die fehlenden Batterien kompensierte er (ungewollt) durch einen Blitzschlag. Seither steht er gewaltig unter Strom und will nichts weniger, als mal eben die Welt retten. Vor der grassierenden Ungerechtigkeit. Zwölf Stunden, eine Nacht ungenehmigten Ausgangs, hat er dafĂŒr Zeit. âEddy Currentâ von 1987 ist eine extreme Parabel ĂŒber mögliche Wechselbeziehungen zwischen Comic und Wirklichkeit, ĂŒber die abgrundtiefe Kluft zwischen Imagination und RealitĂ€t. Aber Ted McKeevers expressives SchwarzweiĂ bannt die Extreme, die Ăberhitzung seiner Figuren und die EiseskĂ€lte der Stadt, skrupellosen Zynismus und einen religiös anmutenden Wahn. Wie elektrifiziert wirkt sein Stil, und jede Menge ĂŒberschĂŒssige Energie setzt auch sein Titelheld frei. Das Dumme ist bloĂ, daĂ der keinen Plan hat und deshalb wie ein elektrischer Don Quichotte durch die Neon-Nacht irrt. Aber ein verlorener Spinner mit einer verzweifelten Mission gerĂ€t geradezu zwangslĂ€ufig an ein GrĂŒppchen versponnener Verschwörerinnen, die mit einem irren HirnwĂ€sche-Plan die Weltherrschaft anstreben. Sie sind fĂŒreinander bestimmt. Und deshalb rettet Eddy am Ende tatsĂ€chlich die Welt - ohne daĂ er es richtig bemerkt. Denn bevor er es - wenn ĂŒberhaupt - je hĂ€tte begreifen können, ist er schon tot. Aber das ist exakt so, wie er sich es vorstellte, denn es kommt wie in seinem Comicbook: Nur wer am SchluĂ stirbt, ist ein wirklicher Held. Wie gesagt, man kann bei der Wahl seines Lieblingscomics nicht vorsichtig genug sein. (Martin Budde)
Platz 73 Flash Gordon
Eine Space Opera (fast) ohne Weltall und Science Fiction (fast) ohne Wissenschaft - dafĂŒr aber umso mehr Fiction und Opera. Flash Gordon ist SciFi-Pulp in Hochpotenz, geadelt von den einzigartigen Illustrationen seines Schöpfers und ersten Zeichners Alex Raymond. 1934 lieĂ das King Features Syndicate von dem 25jĂ€hrigen Zeichner Alex Raymond zwei neue Comicserien fĂŒr die Zeitungs-Sonntagsseiten als Antwort auf die fĂŒnf Jahre Ă€lteren erfolgreichen Vorbilder Tarzan und Buck Rogers entwickeln: Jungle Jim (dt. bei Feest) und Flash Gordon (dt. bei Carlsen). Flash Gordon fliegt mit seiner Freundin Dale Arden und dem Wissenschaftler Dr. Zarkov auf den Planeten Mongo, einer Welt voller futuristischer StĂ€dte, illustrer Königreiche, wilder Bestien, leichtbekleideter Glamour-Queens und schöner Ausblicke auf opulente Landschaften. Einen finsteren Bösewicht muss es natĂŒrlich auch geben: Ming the Mercyless, eine kosmische Variante von Dr. Fu Manchu. Die Handlung erinnert dabei eher an "Mantel und Degen"-Filme als Science Fiction, sie dient eher als Vehikel fĂŒr die StĂ€rke der Serie: Ihren schlagartigen, ĂŒberragenden Erfolg verdankte Flash Gordon den atemberaubenden Zeichnungen Alex Raymonds. Stilsicher von der ersten Seite an setzt er die aberwitzigsten Szenarien in opulente Illustrationen um. Raymonds unerreichtes graphisches Talent lieĂ in in jeder seiner Serien den richtigen Ton finden, aber in Flash Gordon mit seinen romantisch-verspielten Fantasiewelten wird dies am deutlichsten. Immer mehr tritt im Laufe der Jahre das Bild in den Vordergrund: Die Panels werden gröĂer, der Text aus den Sprechblasen in Textboxen am unteren Rand verbannt, und nicht zuletzt die GewĂ€nder der weiblichen Hauptdarsteller immmer knapper. Wie kein zweiter ist Alex Raymond ein "ArtistÂŽs Artist", der unzĂ€hlige Comic-KĂŒnstler von Al Williamson bis Carl Barks inspirierte. Mit seinem tragischen Unfalltod 1956 hinter dem Steuer einer 450 PS-starken Corvette starb Raymond, wie seine Figuren gelebt hatten: Schnell und spektakulĂ€r. Mit Flash Gordon hinterlieĂ er der Welt eine Ikone der Pop-Kultur. (Cord Wiljes) Lesetipps:
 Platz 74
Platz 74
Freddy Lombard
âHey, das ist doch Tim?!â âDer? Nie im Leben!â âAber klar doch - dieses ovale Gesicht, wie eine Null, und fast keine Haare bis auf die typische Tolle!â âAch ja? Und die spitze Nase? Und dieser Name? Freddy Lombard...â Jede Ăhnlichkeit ist hier beabsichtigt: deshalb Lombard, wie das Verlagshaus in BrĂŒssel, das lange Jahre das Magazin âTintinâ (alias Tim) publizierte. Und Freddy, weil das wohl zumindest in französischen Ohren so schön belgisch klingt. Dabei war Yves Chaland, 1957 in Lyon geboren, wahrlich kein Belgier, obwohl er wie kaum ein zweiter den Esprit der frankobelgischen Klassiker zu reanimieren vermochte. Obendrein gleichzeitig in deren beiden wichtigsten Spielarten - in Chalands Werken findet sich deutlich Inspiration sowohl durch HergĂ© wie auch via Franquin und vor allem Tillieux. Dennoch ist Chaland nicht einfach retro - mögen seine Geschichten auch meist aussehen wie aus den 50ern und sogar oft in jener Epoche angesiedelt sein. Selbst deren Ton und Sujets greifen sie auf, aber sie ĂŒberziehen sie, gleich mehrfach ironisch gebrochen. So gibt es in âFreddy Lombardâ den Titelhelden und seine beiden GefĂ€hrten. NatĂŒrlich spielen sie auch Detektiv, ganz wie ihre klassischen Ahnen. Aber zum Trio zĂ€hlt eben ein recht attraktives und dabei ĂŒberlegt handelndes MĂ€dchen. Und das hat es frĂŒher nie gegeben, weder in âSpirou und Fantasioâ (mit der Kollegin Steffanie als Dauerkonkurrentin) und erst recht nicht bei Tim, wo Frauen systematisch ausgegrenzt wurden. AuĂerdem haben die drei stĂ€ndig mit Geldsorgen zu kĂ€mpfen - die handfeste Kehrseite eines solchen Abenteurertums, die einst fĂŒr gewöhnlich dezent unter den Tisch fiel. Da nimmt es kaum Wunder, daĂ die drei - vor allem aber die beiden mĂ€nnlichen Vertreter - in alltĂ€glichen Dingen oft recht naiv und unbedarft wirken. Sie machen dies Defizit aber locker wett durch ihren Enthusiasmus, der die drei Freunde nicht nur immer wieder in Abenteuer verwickelt, sondern ihnen auch letztlich heraushilft, selbst wenn sie oft nur mit einem blauen Auge davonkommen. Diese Begeisterung ist, was sie unmittelbar mit ihren groĂen Comic-Vorbildern verbindet. Deren schlichte, angestaubte Moral allerdings muĂte notgedrungen dem Skeptizismus der 80er weichen. Dabei hatte alles so fröhlich, mit einem Liedchen in strömendem Regen, begonnen: 1981 in der augenzwinkernden Parodie âDas Testament des Gottfried von Bouillonâ, ein kleinformatiges, zweifarbiges BĂ€ndchen (spĂ€ter noch mal durchgĂ€ngig koloriert neu aufgelegt). Zwei Kurzgeschichten knĂŒpften daran an, 1984 in einem Album zusammengefaĂt (âDer Elefantenfriedhofâ), doch schon mit leichten Irritationen wie schwarzem Humor und untypischen Wendungen. Und das nĂ€chste, âDer Komet von Karthagoâ (1986), wirkte richtig verstörend - AlptrĂ€ume, Flutkatastrophe, ein mysteriöser Frauenmord brachen abrupt mit dem nostalgischen, leicht ironischen Zitat. Weltuntergangsstimmung fĂŒr Freddy & Co. Wiederum zwei Jahre spĂ€ter ein Ă€hnliches Sujet, nur verlagert in ein brisantes politisches Thema der Zeit, den Ungarnaufstand 1956: dramatische âFerien in Budapestâ. Und selbst der letzte Band, âF-52â - 1990 erschienen -, nahm nur scheinbar Zuflucht zum Leitmotiv der 50er Jahre, dem Fortschrittsoptimismus: Der Flug im Atomjet fĂŒhrt an menschliche AbgrĂŒnde voller Egoismus und Zynismus, unterlĂ€uft so jeden utopischen Ansatz. Und Freddy und seine Freunde tappen einmal mehr ahnungslos in allerlei Fallen und FettnĂ€pfchen, lösen aber doch ihren Fall. Es wĂ€re spannend gewesen zu sehen, welchen Weg sie weiter gegangen wĂ€ren. Konsequenterweise hĂ€tte ihnen entweder Desillusionierung oder der endgĂŒltige Absturz gedroht, um als edelmĂŒtige Helden in der Gosse zu landen. Aber Yves Chaland starb 1990 bei einem Autounfall. Und mit ihm verlor auch die âNeue klare Linieâ des Pariser Freundeskreises um Chaland, Serge Clerc, Ted Benoit und etliche andere, die sogenannte âEcole de Pigalleâ, ihre Bedeutung, die eine Zeitlang im Frankreich der 80er schwer angesagt war. Was bleibt, ist die Erinnerung - eine doppelte und zudem wehmĂŒtig gebrochene: zum einen an die verlorene Welt der Helden aus den 50ern. Und zum anderen die an Chalands unbeirrten Enthusiasmus, sie trotz allem hochleben zu lassen. (Martin Budde)
 Platz 75
Platz 75
Mort Cinder
Mort Cinders Welt ist dĂŒster, schwarzweiĂ und kontrastreich, wie in alten Holzschnitten. Das Verbrechen, daĂ er begangen hat, ist so unsagbar grausam, das er ĂŒber die Jahrtausende immer wieder zum Leben erweckt wird, um in einer anderen Inkarnation fĂŒr seine SĂŒnden zu bĂŒĂen. Zu seinem Beichtvater wird der Antiquar Ezra Winston, der den ErzĂ€hlungen Mort Cinders mit einer Mischung aus Abscheu und Faszination lauscht. 1962 schuf der in Uruguay geborene Zeichner Alberto Breccia und sein argentinischer Szenarist Hector Oesterheld diese Serie, sicherlich nicht Breccias beste, aber seine zugĂ€nglichste Arbeit. In Lateinamerika haben Comics einen viel höheren bildungspolitischen Stellenwert als etwa in Europa oder den USA. Sie dienen hier nicht nur der Unterhaltung, sondern auch der politischen Agitation und AufklĂ€rung. Sieht man sich Breccias weitere Arbeiten nach Mort Cinder an, etwa die sperrige politische Parabel Perramus oder die verquaste Symbolik in Dracula, so kann man den Druck verstehen, unter dem Comics in einer Diktatur entstehen. Der Leser muĂ lernen zwischen den Zeilen zu lesen und Bilder auf seine eigenen LebensumstĂ€nde umzudeuten. Sicherlich kann man Mort Cinder als reines Horror-Pastiche lesen, seinen tieferen Sinn aber, die Botschaft, das Menschen auch unter den schrecklichsten UmstĂ€nden weiterleben können, versteht man dann nicht. (Lutz Göllner) Lesetipps:
 Platz 76
Platz 76
American Flagg
"Ich habe mit American Flagg einen der fĂŒnf besten Comics der letzten fĂŒnf Jahre gemacht, und ich glaube dennoch, dass es nur ein StĂŒck ScheiĂe ist." Howard Chaykin, Mitte der 80er Howard Chaykin hatte sich einige Jahre als Assistent und Zeichner von so bedeutenden Marvel-Serien wie "Red Sonja", "Star Wars" und "Indiana Jones" verdingt, bevor er den Kanal voll hatte und lieber auĂerhalb des Mediums seine Bagels verdiente. 1983 kehrte er ĂŒberraschend (und ziemlich lautstark) zurĂŒck, weil dank eines neu entstandenen Marktes mit kleineren, unabhĂ€ngigen Verlagen nun auch Comics veröffentlicht werden konnten, die persönlichen Visionen jenseits von Konzern-Interessen folgten. Mit "American Flagg" wirbelte Chaykin auch deshalb eine Menge Staub auf, weil er in einer Serie, die ausdrĂŒcklich fĂŒr Erwachsene bestimmt war, nicht nur die Gewaltspirale anzog (was seit Millerâs "Daredevil" bereits alle gewohnt waren), sondern auch praller (fetischister) Erotik und politischer Satire breiten Raum bot. In einer von den Medien kontrollierten Welt des Jahres 2031 ist Ex-Filmstar Reuben Flagg einer der letzten Aufrechten. In seinem neuen Job als Plexus Ranger (eine Art Polizist mit beschrĂ€nkten Befugnissen) schwimmt er gegen den Strom und tritt dem mĂ€chtigen Plexus- International-Medien-Konzern auch mal in die NĂŒsse. Er bekommt es mit Blackmarket-Basketball-Spielern zu tun, mit Luftpiraten und durchgedrehten Nazis, er kĂ€mpft gegen Korruption in all ihren Formen, gegen Beeinflussung der Massen mittels "Subliminals", also via TV ausgestrahlten Signalen â Chaykin orientierte sich offensichtlich stĂ€rker an dem, was ambitionierte Science-Fiction-Schreiber der Zeit bewegte als an seinen Comic-Kollegen, die immer noch tief im prĂ€pubertĂ€ren Sumpf der Buntbestrumpften steckten. Auch in Stil und ErzĂ€hltechnik unterschied er sich massiv von seiner Zunft. Chaykin machte es seinen Lesern nicht leicht. Sprache und Bildsprache forderten bedingungslose Aufmerksamkeit und einfache Botschaften und Lösungen vermied er wie die Pest. Wer nach all der Anstrengung auf ein erhellendes Wort oder eine Pointe hoffte wurde meist bitter enttĂ€uscht. Die komplexe Darstellung dieser buntschillernden, bösartigen, dekadenten, komischen und in WidersprĂŒchen gefangenene Zukunft selbst war die Message, aber das begriffen damals nur wenige, und alle anderen unterhielten sich lieber darĂŒber, was Chaykin doch fĂŒr eine perverse Sau sei, weil er seine weiblichen Protagonisten in Stilettos steckte. Die monatliche Produktion hielt Chaykin nicht lange durch. Die Stories wurden bald flacher, das aufwendige Artwork simpler â aber die ersten 12 Hefte der Reihe, ebenso wie der grandiose Ableger "Time2", gehören in den Pool der groĂen Meisterwerke der US-Comic-Kunst. Leider nur als schillernde Sackgasse, denn Chaykin folgte vorsichtshalber niemand. Auch er selbst trug seine Ambitionen nach und nach zu Grabe, zeichnete immer weniger und schrieb viel uninteressantes Zeug. Vor allen Dingen arbeitet er heute fĂŒr das US-Fernsehen an zweitklassigen Serien. Von "American Flagg" liegen auf deutsch nur 2 BĂ€nde im Hethke-Verlag vor, die man gelegentlich fĂŒr Pfennige im tiefen Ramsch findet. Zu empfehlen sind die nicht. Es ist aber recht leicht (und nicht sehr kostspielig) bei US-VersĂ€nden wie "Mile High" die einzelnen US-Hefte zu bekommen oder die Graphic Novels "Hard Times" (Heft 1-3), "Southern Comfort" (4-6) und "State of the Union" (7-9). Die Suche nach den beiden "Time2"-Graphic Novels lohnt sich! (Bernd Kronsbein)
Platz 77 Palestine
Joe Sacco hat sein Hobby zum Beruf und seinen Beruf zum Hobby gemacht. Er ist ein comiczeichnender Journalist und ein journalistischer Comiczeichner. Mit anderen Worten, ein glĂŒcklicher Menschen - mit sich und seinem Leben im reinen. Beziehungsweise wĂ€re er das, in einer besseren Welt, wo man als Comicmacher nicht erst den Pulitzerpreis verliehen bekommen oder Monsterpuppen entwerfen muss, um von der Ăffentlichkeit als halbwegs relevante Person gerade mal am Rande wahrgenommen zu werden. Aber lassen wir das... Reden wir lieber von "Palestine", seiner Comic-Reportage ĂŒber den seit Ewigkeiten (in diesem Zusammenhang ist dieses Wort wirklich mal in seiner ganzen Tragweite angebracht) andauernden Konflikt zwischen PalĂ€stinensern und Juden, die das KunststĂŒck fertig bringt, die beiden sich eigentlich abstoĂenden Pole Ăsthetik und Inhalt/Politik/Soziologie in sich zu vereinen. Frei nach dem Motto: Was sich neckt, das liebt sich. Dabei vermeidet Sacco - alle VorzĂŒge des Mediums ausspielend - sĂ€mtlichen, in solchen Diskussionen normalerweise anwesenden, Plattsinn und prĂ€sentiert uns einen hirnzerbröselnden Blick auf die Dinge, der immer um seine eigene BeschrĂ€nktheit weiĂ. Wer dann nach getaner LektĂŒre immer noch von Gut & Böse, Wahrheit & LĂŒge und "Ach, ist Krieg etwas Schreckliches" spricht, der istÂŽs halt selbst in Schuld bzw. einfach nur blöd. Exakt das gleiche lĂ€sst sich ĂŒbrigens auch ĂŒber Saccos "Palestine"-Nachfolger "Safe Area Gorazde - The War in Eastern Bosnia" sagen. Ja, wenn ich mich entscheiden mĂŒsste: "Palestine" oder alles von Alan Moore, diesem gigantischen Giganten... ich wĂŒrde "Palestine" wĂ€hlen und dann zurĂŒcktreten - echt jetzt! (Marc SagemĂŒller) Lesetipps:
 Platz 78
Platz 78
Valerian & Veronique
Wohl kaum eine franko-belgische Serie hat ĂŒber die Jahre so viele Ănderungen mitgemacht wie Valerian. Die ersten drei Abenteuer, die 1967/68 im Pilote vorabgedruckt wurden, entsprachen noch ganz dem klassischen funny-Stil. Gleich in der ersten Story bekam der rationale, obrigkeitsglĂ€ubige Valerian eine gleichberechtigte Partnerin verpaĂt: Laureline (in der deutschen Veröffentlichung nicht ganz so extravagant Veronique genannt) vertritt das weibliche Prinzip, ist rebellisch und gefĂŒhlsbetont. Bereits in den Kurzgeschichten, die bis 1971 erschienen, bereiteten Zeichner MĂ©ziĂšres und Texter Christin den Ăbergang vor. FĂŒr die kommenden Jahre mutierte Valerian zu einer klassischen Science Fiction-Serie mit Fantasy-Elementen und ironische Einsprengseln. Die Reisen auf fremde Planeten und in andere Zeiten dienten immer dazu die Probleme der Jetzt-Zeit zu thematisieren, Christin scheute sich nicht einmal, schwerwiegende philosophische und moralische Fragen in die Geschichten zu integrieren. Der groĂe Bruch kam Ende der 80er Jahre mit der Krise auf dem französischen Albenmarkt. Valerian erscheint seitdem nur noch unregelmĂ€Ăig, jedes neue Album ist ein Event, aber inzwischen einer, der auch allzuoft enttĂ€uscht. Lediglich MĂ©ziĂšres wunderbarer, frei flieĂender Zeichenstil sorgt noch fĂŒr Begeisterung. (Lutz Göllner) Lesetipps:
 Platz 79
Platz 79
Julius Knipl, Real Estate Photographer
Zeitungsstrips sind flĂŒchtiges Cornflakes-Beiwerk. Zeitungsstrips haben Humor, Knollennasen, sprechende Tiere und eine Pointe. Zeitungsstrips sind leicht lesbar. Zeitungsstrips erzĂ€hlen keine Geschichten. Julius Knipl, Real Estate Photographer ist ein Zeitungsstrip von Ben Katchor und hat von all dem kaum etwas â bis auf die Einteilung in zwei Streifen bzw. acht Panel und etwas, was man nach gebĂŒhrendem Einlesen vorsichtig als eine entfernt von Woody Allen und Jim Woodring gestreifte, um drei Ecken gekrempelte Art urban-jĂŒdischen Humors bezeichnen könnte. Knipl, der Name unseres Helden, bezeichnet im Jiddischen das Geld, das eine jĂŒdische Hausfrau fĂŒr NotfĂ€lle auf die Seite legt. Knipl ist unser FremdenfĂŒhrer durch New York, photographischer Chronist der GroĂstadt. Allerdings trĂ€gt Knipl seine Kamera immer verschlossen um den Hals und ist alles andere als unser Auge zur Welt; gelegentlich lĂ€sst ihn Katchor nur mal eben im letzten Bild den gegenĂŒberliegenden BĂŒrgersteig entlanggehen oder am Panelrand im Bistro sitzen. Hauptakteure dieser dezentrierten Momentaufnahmen sind u.a. âThe Drowned MenÂŽs Associationâ, âThe Apartment House Lobby Designerâ, âTV Antenna Thievesâ, âThe Parked-Car Readerâ, âThe Smell of the Post Officeâ oder âThe Impresario of Human Drudgeryâ, um nur einige der mysteriösen, aber immer prĂ€zis inhaltlich orientierten Striptitel zu nennen. In, mit und neben ihnen entwickeln wir langsam die Kartographie eines imaginĂ€ren, höchst wundersamen, doch gleichwohl in zittrigen Linien, schrĂ€gen, aber genauen Perspektiven und allen Spektren von Grau umso genauer erfassten und wirklicheren New Yorks. Unser Blick geht durch die Matrix des New York, das wir kennen, hindurch und fĂ€llt auf das wahre New York dahinter, das New York lĂ€ngst vergessener gymnastischer Apparate, der Geister gefeuerter Gameshow-Moderatoren, der Frisuren-Sammler und der Forscher, die nĂ€chtliche Schreie untersuchen. Mit Julius Knipl sehen wir verschwundene PlĂ€tze und Waren und dem scheinbar Marginalen und Unsichtbaren gewidmete Geheimgesellschaften, besuchen Orte, an denen fast nichts passiert oder stehen nahe bei Knipl selbst, einem einsamen Mann in einer Stadt voller einsamer Menschen. Katchors Texte sprechen eine karge, doch höchst enigmatische Prosa, die uns Kafka oder Borges herbeiassoziieren lĂ€sst, deren zugleich glasklaren und undurchschaubaren literarischen Gebilden man mit Ă€hnlicher Hilflosigkeit ausgeliefert ist wie den Geschichten Ben Katchors. Der Schöpfer dieser einzigartigen Kunst, der aus SchĂŒchternheit niemals Interviews gibt, sagt ĂŒber Julius Knipl: âThereÂŽs a story in everything, you just have to figure out what it is.â NacherzĂ€hlen kann man diese Stories beim besten Willen nicht, nicht mal auf die ĂŒblichen comictypischen heuristischen Hilfsmittel und Kategorien rĂŒckrechnen. Dieser Strip ist ein Wunder an Vorstellungskraft, Intelligenz und OriginalitĂ€t und hat, umÂŽs mit Walter Benjamin zu sagen, âderart fett Aura, dass dir die MĂŒtze wegfliegt.â (Sven-Eric Wehmeyer) Lesetipps:
Platz 80 Usagi Yojimbo
Die Beschreibung "Carl Barks meets Akira Kurosawa", die von William Stout stammt, trifft sicherlich den Nagel nur schief auf den Kopf, ist aber immerhin brauchbar genug, um "Usagi Yojimbo" - einer der konsistentesten und unterschĂ€tztesten Heftserien der neunziger Jahre - auf die Schnelle zu charakterisieren. Zur Rahmenhandlung nur soviel: Langohr-Mifune Usagi geht als herrenloser Samurai (bekanntlich auch Ronin genannt) im feudalen Japan des 16. Jahrhunderts weise aber bestimmt seinen unbestimmten Weg, den so mache Leiche, die es nicht anders wollte, pflastert. Davonrennen tut er nur vor sich selbst - tatsĂ€chlich und metaphorisch. Bewegung in jeglicher Hinsicht ist dabei der SchlĂŒssel und der Sprit, der diese einfache aber alles Wichtige beihaltende Grundidee am laufen hĂ€lt. Always on the run! Wegen des unverkennbaren Genres und weil Zeichner/Autor Stan Sakai Schlitzaugen hat, glauben viele, dass es sich hierbei um einen Manga handelt, was ungefĂ€hr der Behauptung, Miles Davis habe bei den Beatles als KammblĂ€ser ausgeholfen, gleichkommt. Denn selbst fĂŒr einen amerikanischen Comic nimmt sich das Storytelling und die Geschwindigkeit von "Usagi Yojimbo" regelrecht beschaulich bzw. europĂ€isch aus - auch wenn literweise das Blut flieĂt und die Bösewichter in 10er-Trupps das Zeitliche segnen. Schlichtweg aus dem Kimono gehauen hat mich "The Dragon Bellow Conspiracy" (Band 4 der Usagi-SammelbĂ€nde), doch letztendlich sind auch die BĂ€nde 5 bis - na, sagen wir mal - 11 ziemlich super (man beachte, dass die ersten sieben Tradepaperbacks bei Fantagraphics und alle weiteren bei Dark Horse erschienen sind). Die Deutsche Ausgabe bei Carlsen ist lediglich bis zur HĂ€lfte der besagten "Conspiracy"-Storyline gekommen und somit höchstens zweite bis dritte Wahl. (Marc SagemĂŒller) Lesetipps:
 Platz 81
Platz 81
Das blaue Tagebuch
Der Andre Juillard der historischen Abenteuer (Die 7 Leben des Falken) war ein begabter, aber nicht sonderlich spektakulĂ€rer Zeichner, der die ihm anvertrauten Szenarien mit kĂŒhler Distanz und feinem Strich abwickelte. Er wirkte immer etwas steif, wusste nie so recht, Action zu inszenieren, fand aber dennoch ein Eckchen im Herzen der Historienstoffe liebenden Comic-Fans. Der Juillard, der Mitte der 90er plötzlich mit dem "Blauen Tagebuch" auf die BĂŒhne trat, war ein anderer Mensch. Er hatte immer noch einen feinen Strich, er war immer noch ein biĂchen steif und distanziert, aber hier machte das alles Sinn. Als hĂ€tte er endlich den Stoff gefunden, den zu Zeichnen er geschaffen worden war. "Das blaue Tagebuch" (dt. Salleck Publ.) ist eine Gegenwartsgeschichte, unspektakulĂ€r und dramatisch in einem, kĂŒhl und erotisch zugleich, eine Geschichte, die durch ZufĂ€lle in Gang gesetzt wird. Es ist eine schicksalhafte menage-a-trois in einer Zeit verbrauchter GefĂŒhle, in der die Dinge oft nicht das sind, was sie vorgeben und MissverstĂ€ndnisse regieren. Keiner ist ehrlich, und wer glaubt, er sei es, lĂŒgt dennoch. Alles ist kompliziert, jeder steht sich selbst und anderen im Weg. Erinnerungen und Erwartungen setzen Kettenreaktionen in Gang, bei denen jede Energie verpufft. Ăhnlich wie Olivier Assayas beschreibt Juillard eine Zeit der "Winterkinder", in der die, die sich wirklich lieben, nie zueinander finden können. "Das blaue Tagebuch" hinterlĂ€sst ein seltsam leeres GefĂŒhl, ein GefĂŒhl der Beklemmung, als könne die WĂ€rme der Herzen die Eisschicht unter der Haut nicht mehr auftauen. Denn mit mechanischer PrĂ€zision verhindern immer weitere ZufĂ€lle AnnĂ€herung und dauerhaftes GlĂŒck. Wenn die Protagonistin Louise merkt, dass sie aufrichtig geliebt wird und ihre eigenen Irritationen endlich ĂŒberwindet, ist es schon zu spĂ€t. Ihr Blick auf die Uhr ist nur Ă€uĂere Geste eines inneren Zustands, dem in Juillards Geschichte keiner entkommen kann. (Bernd Kronsbein) Lesetipps:
 Platz 82
Platz 82
Der unschuldige Passagier
Ein Mann in einem Boot. Die See ist bewegt, die Wogen schlagen hoch und höher, das Boot voll Wasser. SchlieĂlich schlĂ€gt es um. Und kopfĂŒber, kopfunter wird die Kahnpartie fortgesetzt. Dann schreckt der Mann hoch - aus der Traum -, und die eigentliche Geschichte beginnt. Wie sein âUnschuldiger Passagierâ, so ist Martin tom Dieck 1993 plötzlich in der Comic-Szene aufgetaucht und wurde bestaunt fĂŒr diese absolut eigenstĂ€ndige, eigenwillige Arbeit, die so zwanglos, flieĂend ihr Thema umspielt: eine Suche, erst treibend, dann getrieben, bis besagter Passagier schlieĂlich aus eigenem Antrieb agiert. Im Mittelpunkt steht eine der Ă€ltesten Metaphern der Menschheit: eine Seefahrt. Die ist nicht immer nur lustig (aber diese hier hat einen unverkennbaren, distanziert-ironischen Ton). Man erfĂ€hrt z.B. nicht, wie dieser eher junge Mann an Bord der Barkasse gelangt ist. Schnell wird jedoch klar, es geht aufs offene Meer. Und daĂ der unschuldige Passagier dies nicht gewollt hat. Also fragt er nach dem KapitĂ€n. Nun trifft er wohl auf Mitglieder der Crew, auf Mitreisende, und bei einer geheimnisvollen Expedition in den Schiffsbauch begegnet er gar dem Maschinisten, einer Art Demiurg. Aber nirgends eine Spur vom Spiritus rector des Unternehmens, vom KapitĂ€n. DafĂŒr mehren sich die Anzeichen des nahenden Untergangs, und schlieĂlich bestĂ€tigen drei vorbeiziehende Grazien: einen KapitĂ€n gibt es nicht. Konsequenz: dann lieber gar kein Schiff. Und der Passagier endet, wo es begann - allein in einem Boot, auf bewegter See. Aber nun den Blick gelassen auf den Horizont gerichtet. Man darf diese Geschichte sicher symbolisch nehmen. All ihre elementaren Bestandteile, das Schiff, die See, der KapitĂ€n und schlieĂlich der Passagier selbst, verfĂŒgen in dieser Hinsicht ĂŒber eine altehrwĂŒrdige, Ă€uĂerst reichhaltige Tradition. Und dennoch trieft diese ErzĂ€hlung nicht vor Bedeutung - sie ist so angespannt wie entspannt, so komisch wie konzentriert. Martin tom Diecks DebĂŒt lĂ€Ăt genĂŒgend Spielraum fĂŒr das Lesen und Sehen, fĂŒr das eigene Empfinden, die Stimmungen und Assoziationen, die sich in der Abfolge der Bilder ergeben. Er legt nicht fest, gelegentlich verschwimmen gar GegenstĂ€ndliches und UngegenstĂ€ndliches, und er variiert immer wieder Technik und Stil. Aber diese Geschichte hat trotz allem ihren eigenen FluĂ. Das macht sie bis heute bewegend. (Martin Budde) Lesetipps:
 Platz 83
Platz 83
Tarzan
"Tausend mal schon war Tarzan dem Untergang geweiht. Doch Tarzan lebt." (Tarzan Sonntagsstrip #865) Tausend mal schon ist er kopiert, interpretiert und imitiert worden: Tarzan, Herr des Urwalds - bekannt aus Buch, Kino, Fernsehen, Comic, Sammelbild-Album und Wick-Pastillen-Werbung. Seit Pulp-Autor Edgar Rice Burroughs den Dschungel-Lord 1912 aus der Taufe hob, hatte Tarzan unzĂ€hlige Auftritte. Der beste von allen (vom Original einmal abgesehen) findet sich in den von Burne Hogarth zwischen 1937 und 1950 gezeichneten Tarzan-Sonntagsseiten. Wie kein zweiter versteht sich Hogarth auf Anatomie, auf Sehnen und Muskeln, auf Körper in rasanter Bewegung, zum ZerreiĂen gespannt. Sein an Michelangelo angelehnter Zeichenstil ĂŒberhöht das klassische Ideal des perfekten Körpers ins Ăbermenschliche: Seine Frauen sind die schönsten, seine MĂ€nner die edelsten, seine Löwen die furchterrendsten und seine Elefanten die Gigantischsten. Ăber die Stories breite man dagegen höflich den Mantel des Vergessens, so sich selbiges nicht nach wenigen Stunden von alleine einstellt. Was hier an bunten ScharmĂŒtzeln (mit dem Messer allein gegen drei Löwen oder 100 Wilde) zusammenfantasiert wird, stellt die wildesten prĂ€burtĂ€ren Knabenfantasien in den Schatten. Kann man das heute noch lesen? MĂŒhsam... Einzig erwĂ€hnenswert ist die von Hogarth selbst geschriebene Geschichte um die Ononoes, seltsame beinlose Wesen, die Carl Barks Jahre spĂ€ter als Vorbild fĂŒr seine "Kullern" (BL-OD 9) dienen sollten. ZusĂ€tzlich zu den Sonntagsseiten verfasste Hogarth in den 70er Jahren zwei groĂformatige Tarzan-BĂ€nde "Tarzan of the Apes" (in Farbe, dt. bei Hethke) und "Jungle Tales of Tarzan" (in s/w). Was er in den dazwischen liegenden Jahren als MitbegrĂŒnder und Lehrer an der "School of Visial Arts" und als Autor mehrer FachbĂŒcher ĂŒber anatomisches Zeichnen dazugelernt hatte - hier zog er alle Register seines Könnens. Zwei BĂ€nde fĂŒr die Ewigkeit. (Cord Wiljes) Lesetipps:
Platz 84 Alley Oop
Wie einen Comic anpreisen, den östlich von Cape Cod mal gerade 7 Leute gelesen haben und dessen Handlung/Thema/Inhalt auf den ersten Blick vollkommen daneben scheint? Abgefahren ist da ja schon kein Ausdruck mehr: Ein bĂ€rbeiĂiger Höhlenmensch, der mit einer Zeitmaschine durch die Jahrtausende donnert (Ăgypten, Wilder Westen, Troja, Napoleon, Mond...) und zwischendurch seine beiden Homebases, das Urdorf Moo und das 20. Jahrhundert, mit heftigen Soapstick- bzw. Slapopera-Intermezzi rockt... Da ich mir vollends darĂŒber im klaren bin, dass jegliches weiterlamentieren an dieser Stelle niemanden auf V.T. Hamlins Bartmann auch nur ein Grad heiĂer machen wird, verbleibe ich mit einem vierfachen: Ganz, ganz, ganz, ganz groĂe Kunst! Kitchen Sink Press hat dankbarerweise drei fette Querformater mit Tagesstrips aus den Jahren 1946 bis 1949 herausgebracht, von denen der zweite "The Spinx and Alley Oop" der unmittelbar gefĂ€lligste ist, die jedoch nach meinem DafĂŒrhalten allesamt eine 1+ verdient haben. Leider wurde der Laden vom Pleitegeier aufgesucht, bevor man dort noch den bereits angekĂŒndigten vierten Band veröffentlichen konnte. Das ist der Dank, wenn man den Menschen was Gutes tun will. (Marc SagemĂŒller) Lesetipps:
 Platz 85
Platz 85
Tralalajahal
Zugegeben: Pierre Clements Arbeiten spielen sich am Rand des Mediums ab. In jeder Hinsicht. Sind das ĂŒberhaupt noch Comics? Mir egal. Clement erzĂ€hlt Dutzende von kleinen Geschichten in einem Bild â ohne Sprechblasen/Text, ohne Plot. Kleine Geschichten, eher sogar Momente, die in punkto Charme ziemlich einzigartig sind, und absurd und poetisch und witzig und tragisch und spielerisch und unfassbar phantasievoll. "Wildwechsel" (1988; Alpha) war Ăbung. "Tralalajahal" (1991; Neunte Kunst) ein Meisterwerk, "Les Souris" (1992/93) wurde nach drei ĂŒberformatigen Heften abgebrochen. Das warâs. Was ist aus Clement geworden? Keine Ahnung. Sein schmales Werk steht isoliert, völlig einzigartig und unvergleichlich wie ein Monument im Raum. Ein Monument aus Papier, Luft, Wolken, Spiegeln, Wasser. Im Falle von "Tralalajahal" bevölkert mit Pinguinen, Tigern, Elefanten, Kakteenwesen, Flugnashörnern, Krokodilen, EisbĂ€ren und seltsamen MĂ€nnchen mit dĂŒrren Ărmchen und Beinchen, die durch Murmeln zusammengehalten werden. Sie leben in einer Stadt, in der die riesigen, pastellfarbenen Fresken eines bizarren Kinderzimmers zu wimmelndem Leben erwacht sind. Ein unerklĂ€rliches Leben, das keinen Regeln folgt auĂer denen des Traums. Im Traum Tralalajahals kann man sich verlieren. Nie war Aufwachen lĂ€stiger. (Bernd Kronsbein)
 Platz 86
Platz 86
Die geheimnisvollen StÀdte
Am Anfang war alles Kulisse; mittlerweile geht es darum, die Kulissen Wirklichkeit werden zu lassen. Das Unternehmen der âGeheimnisvollen StĂ€dteâ, 1983 von BenoĂźt Peeters und François Schuiten mit dem Comic-Band âDie Mauern von Samarisâ begonnen, beruht grundsĂ€tzlich auf dem Prinzip der optischen TĂ€uschung. Ebenso geht es aber in den sieben ErzĂ€hlungen und drei MaterialbĂ€nden, die seither erschienen, auch um das Durchbrechen von Mechanismen des sozialen oder des Selbstbetrugs. So entsteht oft ein eigentĂŒmliches SpannungsverhĂ€ltnis zwischen den gigantischen Architekturphantasien Schuitens, die die Serie prĂ€gen, und Peetersâ Figuren, die verloren durch die GebĂ€udefluchten und Stadtlandschaften von ĂŒbermenschlichen AusmaĂen irren, in die Rolle von AuĂenseitern und AusgestoĂenen geraten und sich schlieĂlich gezwungen sehen, den Kampf des Einzelnen gegen einen scheinbar perfekt durchorganisierten Apparat aufzunehmen. Die Legende von den geheimnisvollen StĂ€dten ist ein eklektisches, trickreiches Patchwork, zusammengesetzt aus Motiven der Romantik wie der mechanischen Illusion, klassischer SF - allerdings Ă la Jules Verne, da sich Schuiten ausschlieĂlich der Stilformen um die Jahrhundertwende bedient - und eines magischen Realismus insofern, als gelegentlich historische Namen, Personen und ZustĂ€nde zitiert oder lediglich leicht verfremdet einbezogen werden. Vor allem aber greifen Schuiten und Peeters durch fiktive Dokumente und mittels Inszenierungen oder Dekorationen auch in die Wirklichkeit ein. LĂ€ngst hat ihre Kunstschöpfung die SphĂ€re der reinen Fiktion verlassen und bekundet ihr Anrecht auf RealitĂ€t. So finden sich echte HĂ€userwĂ€nde und Metro-Stationen (in Paris und BrĂŒssel), die nach ihrer Art des Trompe-lâĆil gestaltet sind, auch im âFĂŒhrer durch die geheimnisvollen StĂ€dteâ wieder und werden von Schuiten und Peeters als âOrte des Ăbergangsâ zwischen beiden Welten interpretiert. Will sagen: der Macht der Imagination sind keine Grenzen gesetzt. Das jĂŒngste und wohl gelungenste Beispiel fĂŒr eine solche Transitstation befindet sich aber derzeit auf der EXPO: in der von Schuiten konzipierten Themenausstellung âPlanet der Visionenâ demonstriert eine raffinierte Spiegelungsinstallation auf sinnfĂ€llige Weise, was es mit dem Grundmuster der âGeheimnisvollen StĂ€dteâ auf sich hat. Etwas ist da - und doch nicht da. Man kann es sehen, aber man bekommt es niemals zu fassen. (Martin Budde) Lesetipps:
Platz 87 Andy Morgan
Als 1994 Jan De Bonts Semigurke "Speed" von einigen Feuilletons als DIE Blaupause des Actionkinos gelesen wurde, welche die genetischen und philosophischen Grundlangen des Genres genau auf den Punkt bzw. auf die Mindestgeschwindigkeit brachte, kamen mir und meiner jungen Studi-Weichbirne die ersten groĂen Zweifel an der Welt und dem Horizont von so manchem Schreiberling. Ich saĂ da und dachte nur verzweifelt: Und was ist mit Spielbergs "Duell", was mit "Lohn der Angst" von Henri-Georges Clouzot und vor allem... was ist bitteschön mit ANDY MORGAN, diesem gigantischen, 13 Alben (1967-77) andauernden flotten Dreier, den die drei Mann (Andy, Barney und Ali) auf einem Boot (Cormoran) auf den sieben Weltmeeren veranstalten? Dieser feuchte Traum von einem WeiĂhaarscheitel, der bis zum Erbrechen sein eigener Chef ist und das Highlight einer mittlerweile total auf den Dirty Harry gekommenen belgischen Zeichnerkarriere darstellt, ist nĂ€mlich so blaupausig wie der Affenmann aus "2001". Auch wenn man ĂŒber die Titel prima Witze reiĂen kann (Durch die flammenverwĂŒsteten WĂŒstenmeere von Mexiko ĂŒber die Galapagos-Eisbergen zur FischbratkĂŒche von Fung Lee) möchte ich hier insbesondere auf die drei Alben "An der Grenze der Hölle", "Durch die Flammenhölle von Caranoa" und "Der Hafen der VerrĂŒckten" (diese Wortwahl, Wahnsinn!) hinweisen, die den BĂ€nden 3, 7 und 13 der momentan vergriffenen Carlsen-Gesamtausgabe entsprechen und die - Blaupause hin, Weichbirne her - in jeden Haushalt gehören. (Marc SagemĂŒller)
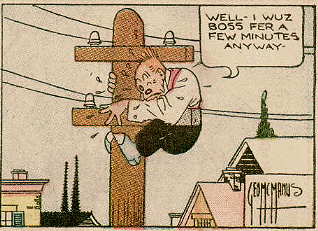 Platz 88
Platz 88
Bringing Up Father
Unter den Comic-Klassikern ist dies der groĂe Unbekannte. Und das in aller Ăffentlichkeit: An "Bringing Up Father" von George McManus (1884-1954) kommt keine ernsthafte Geschichte der Comics vorbei. Aber trotzdem kann heutzutage kaum jemand behaupten, mehr als vielleicht ein Dutzend Seiten des Strips gelesen zu haben. Wenn ĂŒberhaupt. Denn so erfolg- und einfluĂreich die Serie einst war, die McManus 1913 nach diversen anderen, meist kurzlebigen Versuchen begann (ab 1918 auch auf Sonntagsseiten), so rar machen sich heute gesammelte Nachdrucke. Was unter anderem daran liegen mag, daĂ sich ihr Grundmuster stets wiederholt. Und sonderlich originell ist es ebensowenig. Wenn sich nĂ€mlich Jiggs, Ex-Bauarbeiter, nun aber stinkreich (dank Lottogewinn), und Ehefrau Maggie, ehedem WĂ€scherin, permanent streiten, so ist das zunĂ€chst nur das uralte Nudelholz-Stereotyp, das in den ewigen Top Ten abgedroschenster Humor-PlattitĂŒden einen sicheren Platz zwei einnimmt, gleich hinter dem unsinkbaren Inselwitz und noch vor dem obligaten "Herr Ober, auf meiner Fliege ist Suppe"-Prinzip. NatĂŒrlich ist aber entscheidend, was McManus daraus gemacht hat: einen komödiantischen Augenschmaus, bei dem er seine ganze grafische Finesse ausspielen konnte. BerĂŒhmt sind sein souverĂ€ner Umgang mit Linie und FlĂ€che und sein astreines Art-DĂ©co-Design. Aber dieser optische Luxus, wie geschaffen fĂŒr das pompöse, neureiche Ambiente, zu dem sich Jiggs anscheinend nun verpflichtet sieht, wird inhaltlich ausgeglichen durch dessen bodenstĂ€ndiges GemĂŒt, sein unverbrĂŒchliches Festhalten an den kleinen Freuden seiner bescheidenen Herkunft. Genau das ist zwar der Grund fĂŒr den ewigen Zoff mit seinem Ehegespons: Maggie hat einen verbissenen Hang zu Höherem, soweit sich das kaufen lĂ€Ăt. Trotzdem aber auch schon mal schwache Momente, in denen sie eingesteht, daĂ ihre glĂŒcklichste Zeit die Anfangsjahre unter Ă€rmlichen UmstĂ€nden waren. Bei so einer populĂ€ren Botschaft konnte natĂŒrlich nichts schiefgehen. DaĂ Geld allein nicht glĂŒcklich macht, damit trösten sich Heerscharen armer Schlucker, und auch Besserverdienende können dem zustimmen (wissen aber zusĂ€tzlich die beruhigende Seite des Wohlstands zu schĂ€tzen). Kommt noch dazu das schon erwĂ€hnte, Ă€hnlich schlichte Geschlechterklischee. "Bringing Up Father" ist unter den vielen Ehe-und-Famlienstrips wie etwa "Polly", "Blondie" oder heutigentags "HĂ€gar" eindeutig einer der harmloseren und wĂ€re vielleicht schon völlig vergessen, gĂ€be es da nicht diese grafische Brillanz. Und dazu unter der glĂ€nzenden OberflĂ€che noch EinfĂ€lle, die aufmerken und mehr dahinter vermuten lassen. SchlieĂlich ist auch sein EinfluĂ kaum zu ermessen, sein zuweilen ĂŒberschĂ€umender Einfallsreichtum im Detail wie im groĂen Ganzen hat Spuren hinterlassen, von Barks bis HergĂ©. Ob verrĂŒckte Spielereien im Dekors oder paradoxe Ideen, die den gesamten formalen Aufbau einer Seite sprengen, wenn z.B. eine Figur mehrfach aus dem Rahmen fĂ€llt und buchstĂ€blich die Ebenen wechselt: da zeigen sich die ganze ironische Distanz von McManus zu seinem eigenen Tun. Und die souverĂ€ne Beherrschung seines Metiers. Kein Zweifel, McManus war doch ein Genie - nur eben mit einer ausgeprĂ€gten Neigung zu materieller Absicherung und dementsprechenden Kompromissen... (Martin Budde)
 Platz 89
Platz 89
Plastic Man
Die heutigen JLA-Leser hassen ihn: Den roten Gummiball mit der coolen schwarzen Sonnenbrille, der sich selbst Plastic Man nennt und von Grant Morrison vor zwei Jahren in das Line Up ĂŒnernommen wurde. Respektlos Ă€uĂert sich Plastic Man ĂŒber Superman und schiebt den dĂŒsteren Batman stĂ€ndig auf die Rolle. Und so - nĂ€mlich ironisch - war Plastic Man von Anfang an angelegt. Im August 1941 im Police Comics #1 hatte der von Jack Cole getextete und gezeichnete Held seinen ersten Auftritt. Dank eines Unfalls in einer Chemiefabrik kann Plas jede Gestalt annehmen und seinen Körper nahezu unendlich dehnen; nur die Grundfarben - das rote KostĂŒm mit gelb-schwarzen GĂŒrtel - blieb immer gleich. Ein Teil des SpaĂes fĂŒr die Leser bestand in jedem Abenteuer darin, herauszufinden, in welcher Verkleidung Platic Man diesmal auftaucht, um am Ende die Bösen zu ĂŒberfĂŒhren und ihrer gerechten Starfe zuzufĂŒhren. Aber nicht nur die Gangster sahen aus, wie von Tex Avery erdacht, auch Plastic Mans Sidekick war ein dicker, unbeholfener Dussel namens Woozy Winks. Es war wohl diese burleske Mischung aus Krimi-Comic und Cartoonfiguren, die Plastic Man so ĂŒberaus populĂ€r machte. Erst 1959 erwarb DC die Rechte an der Figur und integrierte sie in sein eigenes Superhelden-Universum. (Lutz Göllner) Lesetipps:
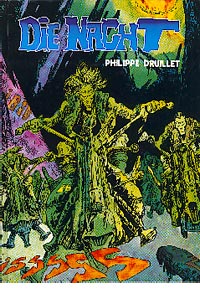 Platz 90
Platz 90
Die Nacht
1974: Paris ist immer noch im Erneuerungsfieber. Die "Humanoides Associes" spielen mit neuen Wegen, SciFi zu machen. Einer der GrĂŒnder, der ehemalige Fotograf Phillipe Druillet, hat schon vorher in SF-Epen wie "Lone Sloane" oder "Yrgael"gezeigt, daĂ er nicht gerade zu den lebensbejahenden Menschen gehört. Das Universum, daĂ er zeigt, ist kalt, gemein und aussichtslos. Sein Held Sloane gleitet ziellos durch die eisige Einsamkeit des Raums, und wenn er auf bewohnte Planeten stöĂt, dann auf ĂŒbervölkerte, dekadente Megazivilisationen, in denen Sex und Gewalt alle Werte abgelöst haben Ă° gezeigt in detailbesessenen, mit pompöser Deco ausgestatteten Wimmelbildern, die es in dieser Form noch nie im Comic zu sehen gab. Der Fatalismus, der aus "Sloane" herausschrie, war keineswegs Pose: Druillet war schon immer depressiver AuĂenseiter gewesen, laut eigener Aussage immer hart an der Grenze zum Selbstmord. Es gab nur 2 Dinge, die ihn davor retteten: seine Arbeit und seine fast heilig geliebte Frau Nicole. In diesem Jahr stirbt Nicole an Krebs. Druillets nĂ€chster Band, "Die Nacht", ist ein einziger Aufschrei, und zwar einer der lautesten, die das Medium bis heute vorbrachte. Was schon vorher in "Sloane" verstörte, gelangt hier zum Konzentrat: die kaputten Helden dieser post-post-post-apokalyptischen Welt sind von Drogen zerfressene Rocker, deren wirrer Lebenskampf um neuen Stoff und gegen alle möglichen tödlichen Gegner an Insekten oder Automaten erinnert. Jedes zweite Wort ihrer Dialoge ist "Tod", und als am Ende in einer riesigen Schlacht um das groĂe "Stofflager" alle Helden getötet werden, erscheinen Fotos von Nicole als Visionen am psychedelisch gefĂ€rbtem Himmel. Druillet ist spĂ€ter sehr reich und berĂŒhmt geworden und seine Seelenpain wurde zwangslĂ€ufig immer stilisierter. Aber der authentische Schmerz von "Die Nacht" trat in den siebzigern die TĂŒr ein fĂŒr viele weitere GesĂ€nge auf die Apokalypse und knistert bis heute unangenehm beim Betrachten Ă° wie ein durchgebrannter Stromkreis. (Thomas StrauĂ)
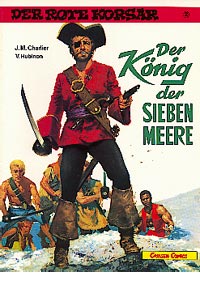 Platz 91
Platz 91
Der Rote Korsar
Unsterblich wurde der Rote Korsar eigentlich durch ganz andere Auftritte: Die vier Hauptpersonen der Serie, Rick, StelzfuĂ, Baba und der Korsar, sind ebenfalls stĂ€ndige Nebenfiguren in Asterix und werden dort in nahezu jedem Album von den Galliern versenkt. Als die beiden Asterix-Schöpfer Uderzo und Goscinny diese Figuren 1964 einfĂŒhrten, geschah dies als Antwort auf den riesigen Erfolg, den Jean-Michel Charlier und Victor Hubinon mit ihrer Reihe Barbe Rouge hatten. Wohl jedes französische Kind, daĂ in den 50er und 60er Jahren Comics gelesen hat, kannte die Serie und verfolgte die KĂ€mpfe der braven französischen Korsaren gegen hinterlistige Briten, sadistische Spanier und gierige HollĂ€nder. Insgesamt 17 Alben entstanden zwischen 1959 und 1974, voller Mantel und Degen-Action, voller geheimnisvoller Intrigen und abenteuerlicher Verwicklungen. Höhepunkt der Serie ist ein Vierteiler, der erst nach einer langen Pause1983 zum Ende kam. Auch wenn der Rote Korsar mit seinen steifen Zeichnungen, seinen seitenlangen Dialogen und seinem simplen Gut-Böse-Schema inzwischen total veraltet wirkt, selbst heute noch - die Serie wird inzwischen von Ollivier, Gaty, Perrissin und Redondo weiter gefĂŒhrt - verströmt sie den klassischen franko-belgischen Charme eines goldenen Zeitalters. (Lutz Göllner)
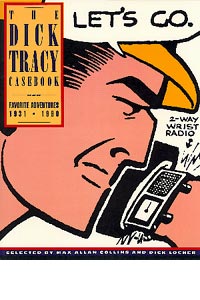 Platz 92
Platz 92
Dick Tracy
Es kann nur einen geben. Obwohl die Ikonographie des rauhen Detektivs mit Hut und Trenchcoat so einvernehmlich klar bekannt ist wie die des verwirrten Professors oder des debilen Comicsammlers, fĂŒllt kaum ein gezeichneter Vertreter dieser Spezies ihre Attribute so ĂŒberzeugend aus wie Chester Goulds Dick Tracy, der ab 1931 (und bis heute; Gould gab die Serie 1977 weiter) den Zeitungsstrips das bot, was zur gleichen Zeit mit Scarface oder The Public Enemy in die Kinos und mit Al Capone in die Schlagzeilen kam. Trotz des Sherlock-Holmes-Profils ist Tracy dessen toughere Variante: ermittelnd, kombinierend, vor allem aber schlagend und schieĂend gegen in den Vierzigern eingefĂŒhrte Bösewichter namens u.a. Trigger Doom, Flattop, Pruneface, The Brow antretend, deren malerische Bizzarerie den Kaneschen Batman-Schurken gleichzustellen ist. Die karikativen Ăberzeichnungen verhalten sich symbiotisch zur harten Gangart und den s/w-Kontrasten, und Gould schafft es, zwischen Geschwindigkeit und StimmungsfĂŒlle das rechte MaĂ zu halten und auf kleinstem Raum so detailliert wie möglich zu arbeiten, ohne die expressive, Rundheit und GröĂe evozierende Abstraktion zu vernachlĂ€ssigen. Warren Beatty schuf 1990 eine respektable Verfilmung. (Sven-Eric Wehmeyer) Lesetipps:
 Platz 93
Platz 93
Kurzgeschichten
1968: die USA im Erneuerungsfieber. Kalifornische Hippies experimentieren mit neuen Wegen, die Welt zu betrachten. Im Oz-Land Kansas strickt ein junger Mann namens Richard Corben, der tagsĂŒber als Trickfilmzeichner in einer Werbefirma arbeitet, an seiner ganz privaten Variante der alten EC-Klassiker. Er behĂ€lt den schwarzen Humor, gibt eine Prise Lovecraft und ein paar Klackse Ăko-SciFi ĂĄ la "Silent Running" und "Phase IV" dazu und kocht daraus ein brodelndes Splatter-SĂŒppchen, in dem es an Blut und GedĂ€rmen genauso wenig mangelt wie an groĂen SchwĂ€nzen und dicken BrĂŒsten. Aufgetischt in einem Stil, der im Grenzbereich von Karikatur (der Strich) und Fotorealismus (die Farben) liegt und dessen ausgezeichnete Beleuchtung seine Bilder schwer und dreidimensional erscheinen lassen - heiĂ und fettig, ideal fĂŒr das Genre. So zog Corben aus und tischte der Welt jahrelang von diesem 100% unverwechselbaren Suppchen auf, und es war gut. Was er in den frĂŒhen 70ern fĂŒr die Warren-Hefte "Eerie" und "Creepie" sowie die Indie-Fanzines "Slow Death" und "Last Gasp" ausschwitzte, setzte tatsĂ€chlich allem die Krone auf, was das Wort "amerikanischer Underground-Horror" ĂŒberhaupt verkörpern konnte und zĂ€hlt bis heute zum besten, was diese Gattung je hervorgebracht hat. In schneller, filmischer ErzĂ€hlweise und triefendem Zynismus beschrieb Corben immer wieder - egal ob böses MĂ€rchen ("Die Bestie von Wolfton"), oft Endzeit ("Mutant World") oder Fantasy-Endzeit ("Rowlf") - die Welt als eine darwinistische Hölle, in der triebgesteuerte Egomanen aufeinander losgehen und dabei hĂ€Ăliche Flecken hinterlassen. Anfang der achtziger begann Corben dann leider, hochnotlangweiliges Hochglanzzeug fĂŒr flachbrĂŒstige Fantasyfreaks zu schustern. Seines glĂ€nzendem FrĂŒhwerks halber verzeihen wir ihm das. (Thomas StrauĂ)
 Platz 94
Platz 94
Zap
Das Baby war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Normalerweise. Doch die Zeiten waren alles andere als normal, 1968 in San Francisco. Und so konnte es ĂŒberleben und Geschichte machen und die westliche Kultur beeinflussen wie wenige Comics zuvor. Zap ist kein Comic. Es ist ein Mythos. Ein AnknĂŒpfungspunkt fĂŒr wahre Geschichten voller Sex und Crime und Drama und Poesie. Z. B. die Story, als jemand Zap Nr. 2 signiert, besoffen einem weiblichen Crumb-Fan aufs T-Shirt kotzt. EntzĂŒckt glaubt die Frau sich von Crumb persönlich beglĂŒckt, schwört, das gute KleidungsstĂŒck nie mehr zu waschen. Wir reden von zusammengeheftetem Papier, das die Rechtslage der USA verĂ€ndert hat. Man erinnere sich: die rechtlichen Verwicklungen um âKeep On Truckinâ (Zap Nr. 1), die juristischen ObszönitĂ€tsdebatten. Wer wird je das Gesicht des Richters vergessen, als Crumbs Anwalt naĂforsch die inzestiöse Satire auf den american way of life, âJoe Blowâ (Zap Nr. 4), mit Archie-Comics verglich. Die Zap-Clique Wilson, Spain, Griffin, Moscoso, Shelton, Williams hat von Rocker bis Esoteriker das Spektrum der Gegenkultur abgedeckt. Das widersprĂŒchliche Nebeneinander war ihre Botschaft. Aber Crumb hat nicht nur alles gestartet, er hat immer wieder in Zap gezeigt, was man mit Comics noch alles machen kann. Man denke nur an âMy Troubles With Womenâ (Nr. 10) oder an âPattonâ (Nr. 11). Meilensteine. Und er hat alle an der Nase herumgefĂŒhrt: Die gewollt jugendliche, radikal moderne Gegenkultur, die ihn feierte, ist niemals die seine gewesen. Seine Gegenkultur ist eine andere, eine besinnliche, melancholische. Er hat Leuten, ohne daĂ sie es merkten, die Schönheit vergangener Stile und Traditionen gelehrt. KĂŒnstler haben nach der LektĂŒre von Zap neue Ufer erreicht. Comic-KĂŒnstler sowieso. Schon kurz vor dem Erscheinen der Nummer 3 (1969) wurde das Baby von den Machern totgesagt. Die Luft sei raus, hieĂ es. Knapp dreiĂig Jahre spĂ€ter erscheint das vierzehnte Heft, mal wieder das letzte â wie schon die Hefte davor. Von Crumb ist nur eine kurze Story dabei, in der er erzĂ€hlt, warum er nicht mehr dabei ist. Die anderen erzĂ€hlen die Geschichte anders. So wird es immer sein. (Elmar Klages) Lesetipps:
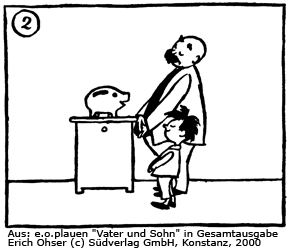 Platz 95
Platz 95
Vater und Sohn
Vater und Sohn - ein deutscher Comic voller zarter Poesie, geschaffen in Zeiten kalter Grausamkeit. 192 Folgen aus der Feder von Erich Ohser unter dem Pseudonym E.O. Plauen erschienen zwischen 1934 und 1937. In ihnen er- und durchlebt das Duo aus dickbĂ€uchigem, gemĂŒtlichem Vater und aufgewecktem, neugierigem Sohn die Freuden und Leiden des ganz normalen Alltags: Vom gemeinsamen Kochen ĂŒber den Versuch, das Heim zu verschönern bis zum Besuch im Zoo. Man lacht mit, niemals ĂŒber die Protagonisten. Dieser warme, freundliche Humor war es, der seinerzeit den phĂ€nomenalen Erfolg der Reihe begrĂŒndete, und noch heute gehört "Vater und Sohn" zu den bekanntesten Comics. 1944 wurde der regimekritische Plauen wegen abfĂ€lliger Bemerkungen ĂŒber Goebbels und Himmler denunziert und beging kurz darauf im GefĂ€ngnis Selbstmord. (Cord Wiljes) Lesetipps:
Linktipps:
 Platz 96
Platz 96
Der Schweinepriester
Bekleidet mit Zigarette und weiter Unterhose, im Schritt pissgelb und im Profil die Eier preisgebend, sonst nichts: der authentischste Schmierlappen des Funny-Universums ist Jean Marc Reisers Schweinepriester. Schreikomisch bis deprimierend nichtig verlĂ€uft sein Leben, das Reiser in je angemessen langen Episoden entfaltet: im Fahrstuhl furzen, Popel essen, Blondinen an den Hintern und Blinden an den Sack greifen, vom Dreimeterbrett pinkeln, auf Erdbeeren niesen und...sterben. Reisers Anarchismen durchziehen nicht nur die Zeichnungen, die in Sachen reduzierteste Krakeligkeit noch Walter Moers toppen und dennoch immer auf den Punkt genau treffen, sondern auch den Regelkanon sonstiger Fun-Comics. Vieles im Schweinepriester ist auf unangenehm naturalistische Art unlustig und âhartâ bzw. lĂ€uft ins witzlose Leere, denn die namenlos bleibende, absolut unsozialisierbare Hauptfigur ist eben kein schwereloser Eulenspiegel, sondern eine abgeklĂ€rte arme Sau, die sich schlieĂlich mit dem Deckel einer Eintopfdose die Pulsadern aufschlitzt. Der SpaĂ ist nach achtzig Seiten endgĂŒltig vorbei, und damit auch Reisers sperrige Studie in Humor und Nihilismus. âGlĂŒckliche Menschen gehn mir auf die Eierâ - wie das eben so ist, wenn es zynische HĂ€nger in gelben Unterhosen wirklich gĂ€be. (Sven-Eric Wehmeyer) Lesetipps:
 Platz 97
Platz 97
Fix & Foxi
Als Rolf Kauka am 13. September 2000 verstarb, gab es unmittelbar darauf kaum einen Nachruf, der nicht mit den Worten eröffnet hĂ€tte: âMan nannte ihn den deutschen Disneyâ. Und kaum einen, der dieses griffige Etikett differenzierte. DaĂ âFix und Foxiâ allerdings mal so etwas werden sollte wie die âdeutsche Antwortâ auf Micky Maus, das war ursprĂŒnglich keineswegs klar. Anfangs ging es allenfalls darum, auf dem gerade entstehenden deutschsprachigen Comic-Markt FuĂ zu fassen, und so hieĂen die ersten Hefte (von 1953) noch âTill Eulenspiegelâ. Die beiden FĂŒchse - samt in Freundschaft verbundenem Widerpart Lupo - kamen erst ein paar Nummern spĂ€ter hinzu, gewannen aber schnell ein spĂŒrbares Ăbergewicht, und schlieĂlich ĂŒbernahmen sie das Heft, das fortan unter ihrem Namen erschien. Und dem Rolf Kaukas, versteht sich. Darin Disney Ă€hnlich, daĂ er seine Signatur zum Markenzeichen veredelte, hatte er sicher von ihm (vor allem) auch das Funny-Animal-Schema entliehen, zu dem man nach den ersten AnlĂ€ufen zĂŒgig ĂŒberwechselte, sowie das Studio-Prinzip. Das ist wohl einer der GrĂŒnde, weshalb die originĂ€ren Kauka-Comics heute pauschal unterschĂ€tzt werden - ihre weitgehende AnonymitĂ€t. Denn Kauka textete, skizzierte bisweilen. Aber Dutzende Zeichner (und Zeichnerinnen!) haben, z. T. jahrelang, die Figuren jeweils unterschiedlich in Szene gesetzt. Nur wenige von ihnen lassen sich relativ sicher identifizieren, und das sind natĂŒrlich meistens die herausragenden, die âgutenâ Zeichner, wie etwa der mysteriöse Becker-Kasch, der stilbildende Walter Neugebauer, der avancierte Florian Julino, der originelle Riccardo Rinaldi und etliche mehr. Sind aber ihre individuelle Formensprache und ihre bevorzugten Themen schon recht vielfĂ€ltig, so kommt noch die schiere Menge aller veröffentlichten Geschichten in âFix und Foxiâ hinzu, und darunter war auch manches schlicht Schrott â ein weiteres Handicap. SchlieĂlich der nachhaltigste Unterschied zu Disney-Comics: bei Kauka ist alles auf eine kindliche Sicht zugeschnitten. Die Hauptfiguren vertreten die Perspektiven und Erwartungen ihres jungen Publikums, es sind Kinder und Jugendliche im Kontrast und oft auch im Konflikt mit der Erwachsenenwelt (selbst wenn Fix und Foxi ganz selbstverstĂ€ndlich Auto fahren oder zum Mond fliegen können). Die besten Geschichten sind deshalb stets die, die diese Grundkonstellation respektieren; und in einigen Nebenserien wie z.B. âPauliâ (v.a. die Stories von Branco Karabajic), âTom und Klein Biberherzâ oder âMischa im Weltraumâ (hier die frĂŒhen Comics von Neugebauer) wird es am konsequentesten prĂ€sentiert. Damit gerieten sie in spĂ€teren Jahren bei manchem Erwachsenen zwar in Verdacht, bloĂ kindisch, belanglos oder gar eskapistisch zu sein. Das macht aber nichts - fĂŒr solch engstirnige Vertreter waren sie auch niemals gemacht. âFix und Foxiâ genieĂen, heiĂt eben ein StĂŒck weit, seiner Kindheit innewerden. Und feststellen, daĂ hier â nahezu einmalig fĂŒr Deutschland in den 50er, 60er Jahren â etliche Comic-Perlen von zeitlosem Rang entstanden. (Martin Budde) Lesetipps:
 Platz 98
Platz 98
Popeye
Popeye ist einer von diesen Comics, bei denen man durch urgemĂŒtliches Faseln ĂŒber solch fabulöse Dinge wie Sonntagsseiten, Tagesstrips, Syndikate, Randolph Hearst und was-weiĂ-der-Comic-Philologe-noch-alles selbst diejenigen vergrault, die prinzipiell Interesse haben könnten. Dabei stehen E.C. Segars (1894-1938) Popeye-Strip und das, was sich Dieter Depp und Heidi Hohl unter einem Popeye-Comic vorstellen, in einem VerhĂ€ltnis zueinander wie KĂ€ptn Ahab zu KĂ€ptn Iglo. Will meinen, dies ist reinster, feinster und derbster Baller-Freestyle, den man selbst bei den AnarchogröĂen Bob Crumb, Carl Barks oder Harvey Kurtzman in dieser abgefahrenen Form nicht findet. Die Metamorphose des Sailors zu einer spinatfressenden Nachkriegs-Ikone ist da nicht nur traurig und langweilig, sondern auch ein absoluter Kulturindustrie-Klassiker, den böse Kapitalisten - so hört man - ihren Kindern zum Einschlafen erzĂ€hlen. Zwar gibt es eine wasserfeste und mindestens 17235 BĂ€nde umfassende Fantagraphics-Ausgabe, doch ich empfehle allen, sich lieber die ĂŒberformatige und supergrandiose Greatest-Hits-Collection "Ich Popeye" zu besorgen, die solche Punkrock-Granaten wie "Popeye und der Jiep", "Popeye sucht Papi" und "Papi auf Schwof" aus der Hochphase um 1936/37 enthĂ€lt und die sich ohne groĂe Probleme auf Börsen finden lĂ€sst. Keine Ahnung, wer fĂŒr diese Auswahl verantwortlich war, aber der oder die muss definitiv den Durchblick gehabt haben. (Marc SagemĂŒller) Lesetipps:
 Platz 99
Platz 99
Komische Bilder
Was komisch ist, darĂŒber hat jeder so seine eigenen Ansichten. Wirklich komisch wirdâs aber meist, wenn jemand seiner Ansicht nach vernĂŒnftig ist. Bernd Pfarrs Figuren jedenfalls handeln streng logisch, ihrer Auffassung gemĂ€Ă. Und bringen dabei jede handelsĂŒbliche Auffassung von Logik zum Platzen. Wie aber sollte ein BĂŒroangestellter, der gerade im Begriff ist, in sein NashornkostĂŒm zu schlĂŒpfen und dabei von einem unangemeldeten Geist ĂŒberrascht wird, anders auf diese Situation reagieren, wenn nicht ratlos? Oder eine Schrottplatz-Crew, deren abendlicher Opern-Besuch von dichtem Nebel vereitelt wurde, was könnte sie besseres tun, als wenigstens noch einmal gemeinsam das Libretto studieren? Oder wenn sich schon jemand arg verunsichert fĂŒhlt und er keinen anderen Halt weiĂ als ein Gummitier - warum sollte es fĂŒr ihn Naheliegenderes geben, nachdem er die Sinnlosigkeit seines Tuns einsehen muĂte, als es mit vier Gummitieren zu versuchen? All das muĂ uns doch sehr vernĂŒnftig vorkommen, denn unsere Vernunft bedient sich ja keiner anderen Methode, als aus Erfahrungen SchluĂfolgerungen, aus SchluĂfolgerungen Erwartungen abzuleiten. Tritt dann aber doch das Unerwartete ein, dann erscheint uns das komisch. Und das Unerwartete ist Bernd Pfarrs Metier. Mit sicherem GespĂŒr entdeckt er unzĂ€hlige Situationen, die unserer Schulweisheit bislang unbekannt waren, und verfertigt darĂŒber âkomische Bilderâ (so der Titel eines seiner lehrreichen Sammelwerke), also anschauliche Abhandlungen in Text und Illustration, die uns den Umgang mit dem Unerwarteten vertraut werden lassen. Wir reagieren darauf mit erkenntnissattem GelĂ€chter, glĂŒcklich, wieder unverhofft etwas ĂŒber die groĂe, unfaĂbare Welt drauĂen erfahren zu haben. Pfarrs prĂ€gnante und obendrein geschmackvoll gestaltete Bildertraktate erklĂ€ren mit jedem Wort, in jedem Strich: So gehtâs. So kannâs gehen. Und: nur weil der Mensch vernunftbegabt ist, ist er auch komisch. Noch eine Erkenntnis, Pfarr sei Dank. (Martin Budde) Lesetipps:
 Platz 100
Platz 100
Astro Boy
"Osamu Tezuka? Nie gehört! Wer soll das sein?" Eine solche Reaktion ist hierzulande die Regel, in Japan dagegen völlig unvorstellbar: Dort wird Tezuka bewundernd "Gott des Manga" genannt und sein Tod 1989 wurde von einer Ă€hnlichen Medienresonanz begleitet wie der des japanischen Kaisers Hirohito nur wenige Wochen zuvor. Tezuka war es, der nach dem II. Weltkrieg den heute so typischen Manga-Stil (Wasserkopf, untertassengroĂe Augen) einfĂŒhrte, der als erster Geschichten in epischem AusmaĂ ĂŒber hunderte bis tausende von Seiten erzĂ€hlte, der dynamische Elemente des Films in Comics ĂŒbernahm, und er war auch Vorreiter mit den ersten Mangas fĂŒr MĂ€dchen und speziell fĂŒr Erwachsene. Die Zahl der Figuren, die in Tezukas ĂŒber 40jĂ€hrigen Comic- und Filmschaffen der Feder dieser Ein-Mann-Traumfabrik entsprungen sind, sind Legion. Auf ĂŒber 150.000 Seiten Comics und hunderte Stunden Film summiert sich sein Lebenswerk. Doch was ist hiervon bis an unsere Gestade gespĂŒlt worden? Einzig "Kimba der weiĂe Löwe" (Janguru Taietei), von Tezuka selbst 1950-54 fĂŒrâs Fernsehen produziert, ist hierzulande zumindest der Generation Yps ein Begriff. Eine von Tezukas berĂŒhmtesten Kreation, "Astro Boy" (Tetsuwan Atomu = Eisenarm Atom), erreicht uns erst jetzt: Der kleine Roboter mit den riesigen KrĂ€ften, der wie ein moderner Pinocchio von seinem Vater aus unbelebter Materie erschaffen wurde, muss sich auf 3.000 Comicseiten seinen Platz in der Gesellschaft mit guten Taten erkĂ€mpfen. Dass es dabei jede Menge GATSCHAMM und KAWAWAMM bei KĂ€mpfen mit Superschurken und deren ĂŒberdimensionierten Robot-Monstren gibt, versteht sich fast schon von selbst. Tezukas Grafik ist erfrischend reduziert und ein Genuss fĂŒr die Augen, wobei sich ein Vergleich mit Herges Ligne Claire geradezu aufdrĂ€ngt. Die fĂŒr Mangas heute so charakteristischen dynamischen Layouts und filmschnittartigen Perspektivwechsel werden hier bereits virtuos vorweggenommen. Tezukas letztes groĂes Werk war "Adolf", die Geschichte zweier Jungen wĂ€hrend der Nazi-Diktatur. Zeit seines Lebens ein erklĂ€rter Gegner von Krieg und Rassismus entwickelt er vor diesem historischen Hintergrund seine Lebensphilosophie: Ein tiefgreifender Humanismus, die Liebe zu allen Geschöpfen und die Aufforderung, die eigenen Ideale zu leben. In Astro Boy hatte er dasselbe bereits 40 Jahre zuvor spielerisch gesagt. (Cord Wiljes) Lesetipps:
Leseproben:
|

|